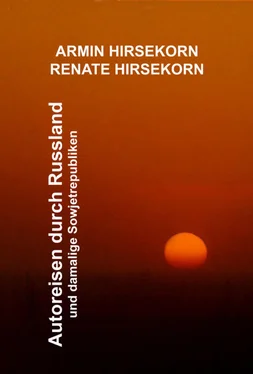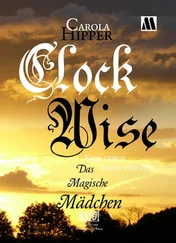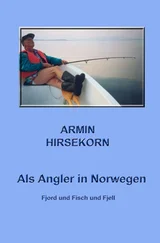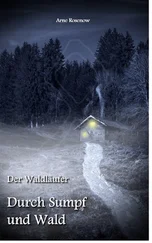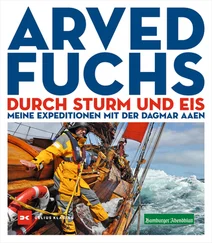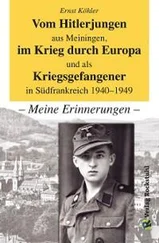Während Renate und ich unser Abendessen einnehmen, kommen wir etwas umständlich ins Gespräch mit den Nachbarn. Man verständigt sich erneut in diesem Gemisch aus russischen und englischen Brocken. Der Tischnachbar lädt uns zu einer Flasche Wein ein, und wir kommen auf Dresden zu sprechen. Was für eine interessante Stadt, meint der Aserbaidschaner: der Zwinger, die Gemäldegalerie, die Schätze im Grünen Gewölbe. Der Mann ist gut informiert, ein Bergbauingenieur, der viel in der Welt umhergekommen ist. Er kennt auch die Bergakademie in Freiberg, Sachsen. Uns spricht er seine Bewunderung aus, ob unserer so weiten Autoreise und die Flüge in die mittelasiatischen Zentren.
Wir interessieren uns für Baku, für die Ölförderung im Kaspischen Meer, wo 1873 die erste Ölquelle angebohrt wurde. Die von den Gebrüdern Nobel gegründete Ölgesellschafft hatte sich in wenigen Jahren zum führenden Unternehmen in der Welt entwickelt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lieferte es die Hälfte des weltweit benötigten Erdöls. Doch in den Folgejahren, nach der Erschließung weiterer Erdölfelder vor allem im mittleren Osten, verlor es zunehmend an Bedeutung.
Nach knapp zwei Stunden verabschieden wir uns von den Tischnachbarn. Unser freundschaftliches Gespräch endet mit einer Einladung: Renate und ich sind herzlich nach Baku eingeladen. Er wäre stolz, meint der Aserbaidschaner, uns die wunderschöne Stadt, seine Umgebung und das Erdölunternehmen, auf Pfählen, mitten im Kaspischen Meer, vorzeigen zu können.
Am nächsten Tag, es ist der 7. Oktober 1978, begrüßt uns eine Reiseleiterin an der Rezeption, des Hotels. Sie setzt sich neben mich in den LADA, und es beginnt die von uns gebuchte Stadtrundfahrt. Sie führt in den Keller einer Kelterei, zum Palast des ehemaligen Gouverneurs Woronzow, in den Hafen, zur Freitreppe und in die Umgebung der Stadt, zu einem Erholungspark und einem der vielen Badestrände an der Schwarzmeerküste.
Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das im historistischen Stil erbaute Opernhaus, geplant durch ein Wiener Architekturbüro und eröffnet im Jahre 1887. Vorläufer war das im Jahre 1809 eröffnete erste Theater in Odessa, als Werk eines St. Petersburger Architekten, ein im klassizistischen Stil errichtetes Gebäude. Durch einen Brand im Januar 1873 wurde es vernichtet.
Früh um halb sieben Uhr, am folgenden Morgen, starten wir unseren LADA bei recht trübem Wetter zur Fahrt nach Kiew. Die breite Ausfallstraße ist bestens in Schuss, wir kommen zügig voran, fahren durch die fruchtbaren südlichen Regionen der Ukraine. 293 Kilometer liegen vor uns, vorbei an abgeernteten Getreide-, Sonnenblumen- und Maisfeldern von gewaltiger Ausdehnung. Die Fahrt führt uns fast unmerklich über viele Kilometer bergauf und bergab. Ist man auf einer Höhe, hat man einen weiten Überblick auf die Fahrbahn und die umliegende Landschaft. Es ist noch früh am Tage, und der Himmel ist über und über mit einer grauen Wolkenschicht überzogen.

Abbildung 27: Am südlichen Bug, Straße von Odessa nach Kiew.
In einer Niederung, zwischen langestreckten Höhenzügen, erreichen wir eine Brücke, daneben steht ein Holzschild mit dem Namen des Flusses: „Южныѝ Буг“, südlicher Buch. Im Nebel der Niederung sind die Häuser im nahen Dorf nur als dunkle Schatten auszumachen. Eine am Ufer des Gewässers angepflockte Ziege schaut unserem Treiben neugierig zu. Wir haben angehalten und parken das Auto in einer Ausbuchtung der Straße. Noch in Odessa hatten wir etwas Brot und Käse eingepackt, nun, am nördlichen Ufer des Flusses, machen wir eine kurze Fahrpause und frühstücken.
Als wir weiterfahren, treffen wir irgendwo, auf halbem Wege nach Kiew, auf einen einsamen Gasthof. Recht modern und gepflegt schaut er aus, sicher ist er erst vor wenigen Jahren erbaut worden. Wir sind die einzigen Gäste, halten uns jedoch nicht lange auf, sondern schauen uns nur mal kurz um und trinken ein Glas Mineralwasser.
Bereits um frühen Nachmittag, um 15.00 Uhr, erreichen wir das Motel „Prolisok“, am Rande von Kiew. Es bleibt mir nicht viel Zeit für die Anmeldung in der Unterkunft und die Unterbringung des LADA in der Werkstatt. Doch beides klappt fix und ohne Probleme: In der Rezeption wird uns der Flug nach Taschkent für morgen, 15.00 Uhr, angekündigt; man würde uns um 12.00 Uhr mit dem Wolga abholen. Und auch in der Werkstatt nimmt ein freundlicher Meister unser Fahrzeug zur Reparatur entgegen und meint, auch die Unterstellung für die folgenden drei Wochen sei gesichert.
Renate und ich sind glücklich, dass alles so gut und ohne unangenehme Überraschungen geklappt hat. Wir setzen uns in das Hotelrestaurant, bestellen uns ein Abendessen und trinken nach dieser langen und erlebnisreichen Anreise zum Flug nach Mittelasien eine Flasche Sekt.
Für den Sommer 1982 hatten wir uns auf eine Reise der Autotouristik über den Goldenen Ring um Moskau entschieden. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen, unser Reisegepäck lag gestapelt im Arbeitszimmer, und wir waren schon in bester Reisestimmung, als mir ein gewaltiges Unglück widerfuhr: Am frühen Morgen, bei der Fahrt zur Arbeit, hatte ich einen Autounfall. Unser Fahrzeug war im Motorbereich total verbeult, die Vorderachse verzogen. In der DDR musste man in solch einem Fall oft ein halbes Jahr auf einen Reparaturtermin in der Werkstatt warten.
Ein guter Freund, der sich für einige Jahre mit seiner Ehefrau in der Moskauer Umgebung zur Arbeit aufhielt, lieh uns seinen Moskvich. Doch das Auto war abgemeldet, ich hatte eben noch Zeit, es wieder anzumelden und den Versicherungsbetrag auf meinen Namen einzuzahlen. Das sollte sich später, am Grenzübergang Brest, als großer Glücksumstand erweisen.
Am 8. Juni reisen wir in Warschau zur Übernachtung bei unserem polnischen Freund Zbyschek an. Bei der Fahrt durch Polen begegnen uns nur insgesamt 37 Fahrzeuge. Wir treffen vor fast jeder Stadt auf Armeekontrollpunkte und fahren an vielen Investruinen vorbei. Benzin ist rationiert, tanken dürfen die polnischen Bürger nur nach Endziffer der Autokennzahl, so zum Beispiel am 9., 19., 29. des Monats jeweils zehn Liter, Kosten je Liter: 32 Zł. Auch Alkohol und Fleisch ist rationiert: zwei Liter Schnaps und zweieinhalb Kilo Fleisch pro Person und Monat. Wie unmittelbar nach dem Kriege blüht der Schwarzmarkt.
Was bisher bei unseren weiten Fahrten mit dem LADA nie notwendig war, nun aber mit dem geliehenen Moskvich: Ich muss mich zur Reparatur in eine Werkstatt bemühen, um Kolben, Bremskreis und Rückleuchte in Ordnung bringen zu lassen.

Abbildung 28: Links unser Moskvich, rechts ein russischer, mit Stalinbild an der Frontscheibe.
Am nächsten Morgen, es ist der 9. Juni, fahren wir weiter nach Brest und halten um 12.45 Uhr am Grenzübergang. Ein Grenzoffizier nimmt uns in Empfang: „Докуменуы пoжалуйста!“ Ich überreiche ihm unsere Ausweise und die Fahrtenpapiere. Er schaut sie sich an, blättert sie einzeln durch und stutzt, - schaut auf, wirft einen Blick auf das Fahrzeug, auf das Schild mit der Kennziffer und meint: „Прохода нет!“ – Kein Grenzübergang möglich!
Und der Grund? Auf den Fahrtpapieren ist der Lada mit seinem Kennzeichen angegeben, doch wir sind mit einem Moskvich unterwegs. Renate spricht etwas besser russisch als ich. Sie versucht dem Oberleutnant beizubringen, dass wir einen Unfall hatten und ein Freund uns sein Fahrzeug geliehen hat.
Ob das bei uns in der DDR möglich sei, ist die Frage des Grenzbeamten. Ja, ist meine Antwort und als Beweis zeige ich ihm die Fahrzeugpapiere. Doch auch das überzeugt den Mann nicht: Da sei doch der Name eines anderen Besitzers vermerkt. Er wird erst recht misstrauisch und schaut mich skeptisch an. Das geht so eine ganze Weile hin und her, zum Teil in gebrochenem Russisch, zum Teil mit einigen englischen Brocken. Alles ist jedoch erfolglos, der Mann lässt uns nicht passieren.
Читать дальше