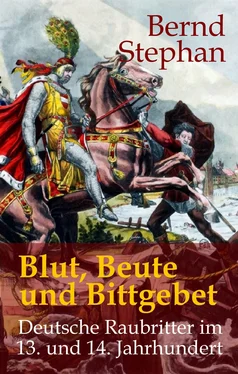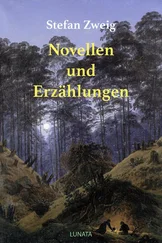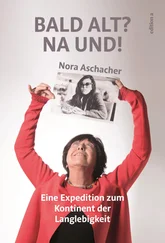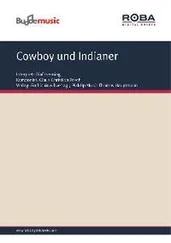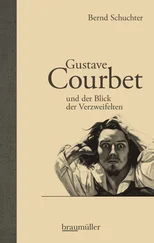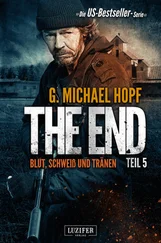Denn wie aus dem Boden gewachsen ragte unvermittelt ein Hüne von einem Mann vor dem Heckenreiter auf. Der Bauer wollte nicht in hilfloser Wut zusehen, wie seine Frau von diesem Kerl und womöglich von noch anderen Haderlumpen vergewaltigt wurde. In den Fäusten hielt er eine langstielige Axt.
Der Heckenreiter schnaufte unwillig und griff nach seinem Schwert. Aber bevor er die Klinge auch nur halb aus der Scheide gezogen hatte, wirbelte das Axtblatt bereits über seinem Kopf und sauste herunter.
Kein Schrei brach mehr über seine Lippen. Eisenspäne aus den Helmpartien, Knochensplitter, Haarsträhnen und das rechte Ohr mit sich reißend, verschwand die Schneide zwischen den Nackenmuskeln.
Die Axt spaltete den Rumpf des Unholds bis zum Gurt. Blutüberströmt sank er dem Bauern vor die Füße.
Dann jedoch waren die Eindringlinge zu fünft über ihm. Schwerthieb um Schwerthieb hagelte auf den Hünen herab.
Obwohl er schon unter den Schlägen taumelte, grub er noch einem Plünderer die Axt in die Stirn. Der Kerl brach in ein viehisches Gebrüll aus und stürzte wie ein gefällter Baum rücklings um. Auch der Bauer brach zusammen.
Friedrich von Rabenswald-Wiehe bebte vor Zorn, als er sah, wie mehrere Burgleute die dralle Bäuerin zu einer Hausecke schleiften. Zwei Kerle warfen sie nieder, zerrten ihr den Kittel vom Leib, spreizten ihr die Beine und hielten sie fest.
Sechs, sieben Männer befriedigten sich an ihr wie die Tiere. Anfangs versuchte sie noch, sich zu wehren. Sie schrie, spuckte und biss. Doch irgendwann ließ sie alles stumm über sich ergehen.
Dem Grafen fiel es schwer, seinen Zorn zu zügeln. Doch das Treiben zu unterbinden, wäre ein noch gröberer Fehler gewesen.
Seine Augen schweiften über die toten Waffenknechte. Die musste er nun in die Burg zurückkarren, damit der Burgkaplan ein Gebet für ihre armen Seelen murmeln konnte, bevor sie verscharrt wurden. Über den von zahllosen Schwertklingen bis zur Unkenntlichkeit aufgeschlitzten Bauern glitt sein Blick hinweg wie über einen Sack Lumpen.
Der Wilde Rabe atmete tief ein und aus. Nun, wenn das Geschäft blühte, so konnte man ja gönnerhaft den Wünsche der Knechtschaft entsprechen. Wer freilich nach Ende des Spans aufmucken sollte, den würde er nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern selbst die Schlinge um den Hals legen.
Mit einer herrischen Handbewegung winkte er seinen Burgvogt heran und befahl ihm, das Beladen der Bauernwagen zu beenden und sich in Bewegung zu setzen. Gelfrad von Heseler sollte mit der Hälfte der Leute das erbeutete Gut zur Burg Rabenswald schaffen.
Er selbst würde mit der anderen Hälfte über einen Umweg folgen.
Zwischenfall auf der Strata Regia
Während der Burgvogt den Weg zur Hohen Schrecke nahm, lenkte Friedrich von Rabenswald-Wiehe seinen Vierbeiner in die entgegengesetzte Richtung. Konrad von Balgstedt und ein Dutzend Burgleute schlossen sich ihm an.
Der Graf beabsichtigte, vor der Rückkehr in seine Burg die Strata Regia auszuspähen. Der Ritt sollte ihm die Erkenntnis vermitteln, ob es sich lohne, den Span auf einen Kaufmannszug zu planen oder nicht.
Speck hin, Speck her. Ein Burgherr brauchte eben nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch gemünztes Silber. Gemünztes Silber für die Begleichung von Schulden, für ausgefallene Wünsche der gräflichen Sippe, für besondere Gefälligkeiten der Dirnen, für den Unterhalt der Waffenknechte und die Instandsetzung der Burganlage.
Silbermünzen vermochte ein mittelloser Burgherr freilich nur herbeizuschaffen, wenn er einen Handelsszug überfiel und die Planwagen rupfte wie feiste Mastgänse. Oder er hielt die Pfeffersäcke im Burgverlies fest, um für deren Herausgabe ein sattes Lösegeld zu erpressen.
Doch alles das war schneller gesagt als getan. Denn die einträglichen Zeiten des Interregnums , als die Pfeffersäcke ihre mit Kaufmannsgut beladenen Frachtwagen noch einzeln losgeschickt hatten, waren vorbei.
Gegenwärtig durfte ein verarmter Adelsherr bestenfalls davon träumen, einen Handelszug zu schröpfen. Kaufleute, die mit ihren Planwagen allein auf den Handelswegen reisten, entdeckte man nur noch in Ausnahmefällen.
Heutzutage fanden sich die Pfeffersäcke zusammen und bildeten Geleitzüge. Ihre Waren rumpelten in Kolonnen von bis zu zwei Dutzend Planwagen, jeder von vier oder sechs Pferden gezogen, über die Fernstraßen. Und zu beiden Seiten der Fuhrwerke gingen oder ritten bewaffnete Kriegsknechte, manchmal 50 Mann an der Zahl.
Doch nicht nur das war es, was einem Burgherrn die Luft zum Atmen nahm. Mehr noch beschwor Unheil herauf: Denn seit anderthalb Jahrzehnten gab es nun wieder einen König im Heiligen Römischen Reich.
Um den Griff des unerwünschten Böhmenkönigs Ottokar Przemysl nach der Krone zu verhindern, hatten die sieben deutschen Kurfürsten am 1. Oktober 1273 in Frankfurt am Main den wenig begüterten und einflusslosen Grafen Rudolf von Habsburg zum König gewählt. Dafür war zuvor dem böhmischen Königreich das Kurrecht entzogen und dem Herzogtum Bayern zuerkannt worden.
Vor der Wahl hatte Rudolf von Habsburg den sieben Kurfürsten freilich in die Hand schwören müssen, dass er im Verlauf seiner Herrschaft das seit der Stauferzeit eingebüßte Reichsgut zurückführen, das Raubrittertum beseitigen und die Vielzahl unangemessener Zölle tilgen würde. Und der Habsburger hielt Wort.
Auf dem Hoftag zu Nürnberg im August 1281 verkündete er, dass alles nach der Absetzung Friedrichs II. usurpierte Königsgut wieder herauszugeben sei. Anschließend ging der König daran, die deutschen Territorien von einer Landplage zu befreien – von den Raubrittern.
Zunächst setzte Rudolf von Habsburg dem Treiben der rheinischen Ritter ein Ende, die von ihren geschützten Burgen aus Frachtschiffe und Kaufmannswagen überfielen und ausplünderten und eigensinnig am Grundruhrrecht als legitimierten Warenraub festhielten. 1282 erschien er mit einem Heerbann im Rheingau.
Burg Sooneck fiel, der Burgherr – ein Edler von Waldeck – geriet mit seiner Bemannung in Gefangenschaft. Trotz des Einspruchs der Adelssippe von Waldeck, die nicht zu fassen vermochte, dass ein Familienangehöriger schimpflich erhängt werden sollte, ließ Rudolf von Habsburg die Raubgesellen an den Bäumen entlang des Rheinufers aufknüpfen.
Um Burg Reichenstein zu bezwingen, bedurfte es mehr Zeit. Sturmangriff um Sturmangriff wehrte der Burgherr Dietrich von Hohenfels mit seinen neun Söhnen und der restliche Besatzung ab.
Vier Jahre lang mussten die königlichen Dienstleute Reichenstein belagern, ehe die ausgehungerte Burgmannschaft aufgab. Zumindest Dietrich von Hohenfels schaffte es, sich der Gefangennahme durch Flucht zu entziehen.
Die Landplacker von Burg Reichenstein erlitten das gleiche Schicksal wie die Raubgesellen von Burg Sooneck. Beide Befestigungsanlagen wurden geschleift.
Die Zerstörung der Raubnester am Mittelrhein hatte gezeigt, dass König Rudolf I. entschlossen war, die Landplackerei mit der Wurzel auszurotten. Und schon schwirrten Gerüchte umher, er habe vor, in Franken und Schwaben und Thüringen gleichermaßen zuzupacken ...
Friedrich von Rabenswald-Wiehe presste die Zähne aufeinander. Bei der Vorstellung, dass auch seine Burg geschleift werden könnte, bildete sich ein Eisklumpen in seinem Magen. Doch dann schüttelte er den behelmten Kopf, als wollte er die trüben Gedanken verscheuchen.
Nach wie vor ritt er an der Spitze der Schar. Auf einer von Wasserfurchen durchsetzten Wagenspur ging es nach Süden. Hinter dem ausgeplünderten Dorf änderte sich die Landschaft. Jetzt schlängelten sich die Spurrillen durch gewelltes Hügelland, das den Heckenreitern bessere Sichtverhältnisse bot. Gelegentlich säumten Waldstreifen oder Baumgruppen den Weg.
Die Wagenspur führte nicht geradewegs zur Strata Regia, sondern verband die Bauerndörfer der Umgebung miteinander. Wenn eine solches in der Ferne heraufwuchs, bog Friedrich von Rabenswald-Wiehe in die Wiesenflur ein, um die Siedlung zu umreiten.
Читать дальше