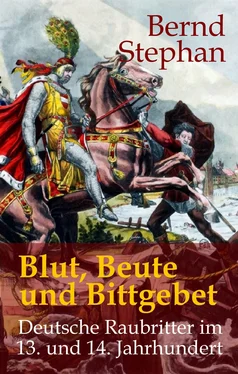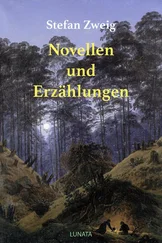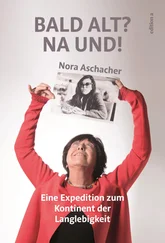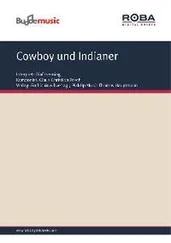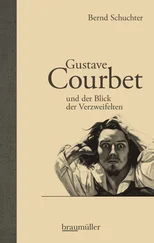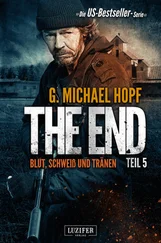Andere Ritter lauerten entlang der Handelsstraßen den Reisenden auf. Die Überfallenen brachten sie in ihre Burgen und hielten sie in den Verliesen fest. Ziel der Strauchritter war es, für die gefangenen Kaufleute Lösegeld zu fordern.
Obwohl die ritterlichen Burgherren ihr Überleben indessen fast ausnahmslos durch Plünderungen, Wegelagerei und Verschleppungen zu sichern suchten, verbesserten sich ihre Lebensumstände kaum. Die Erkenntnis, dass sie trotz fortwährender Beutezüge arm wie Kirchenmäuse blieben, wirkte ernüchternd auf sie. Folglich blieb ihnen nichts anderes übrig, als danach zu streben, durch aufsehenerregende Unternehmungen eine Verbesserung des bestehenden Zustands herbeizuführen.
Angesichts solcher Schlussfolgerungen kam es 1255 zu einer Untat, die ein Schlaglicht auf die Entwicklung werfen sollte, die sich mehr und mehr abzuzeichnen begann. Denn im November dieses Jahres raubte ein rheinpfälzischer Burgherr nicht etwa eine Bauerndirne oder die Gemahlin eines Fernhändlers, sondern eine leibhaftige Königin ...
Ein Schneeschleier bedeckte die Erhebungen und Hänge der Haardt. Auch die Bäume beiderseits des Fahrwegs, der parallel zum Ostrand des Waldgebirges verlief, trugen das makellose Weiß frisch gefallenen Schnees. Am Tag zuvor hatte es in der Vorderpfalz geschneit.
Heute fiel kein Schnee mehr. Es war sonnig, aber kalt an diesem Tag.
Auf dem Fahrweg zogen etliche Reiter und zwei Wagen nach Süden. Der Zug bestand aus etwa einem Dutzend gewappneter Reiter, die vier berittene Damen und zwei Reisewagen begleiteten. Die Reiter kamen aus der Bischofsstadt Worms und wollte zur Reichsburg Trifels im Wasgau. Dort hielt sich im November 1255 der von den rheinischen Erzbischöfen gewählte König Wilhelm von Holland auf.
Graf Adolf von Waldeck ritt an der Spitze des Zuges. Sein Auftrag lautete, Wilhelms Gemahlin unterwegs Schutz und Sicherheit zu gewähren. Königin Elisabeth beabsichtigte, zusammen mit ihrem Eheherrn und dem Sohn Florens auf dem Trifels das Weihnachtsfest zu feiern. Wilhelm von Holland war mit der Tochter des Herzogs Otto I. von Braunschweig-Lüneburg seit drei Jahren verheiratet.
Der Reiter neben dem königlichen Hofrichter trug ein prunkendes Wappenbanner im Sattelschuh, das den steigenden Löwen der holländisch-seeländischen Grafen zeigte. Jeder sollte erkennen, welch eine edle Dame die Gerüsteten eskortierten.
Adolf von Waldeck und dem Bannerträger folgten sechs Gewappnete. Ihnen schlossen sich Königin Elisabeth und ihre drei Gesellschafterinnen im Damensattel an. Dahinter rumpelten ein Tross- und ein Kastenwagen. Florens, der einjährige Sohn des Königspaares, befand sich in letzterem Gefährt. Den Schluss des Zuges bildeten weitere Reiter im Harnisch.
Der Atem der Menschen und Tiere verwehte in der Kälte, die Pferdehufe wirbelten den lockeren Schnee auf, die Rüstungen der Reiter schimmerten im Sonnenschein. Doch dafür hatte der Hofrichter so wenig einen Blick übrig wie für die winterliche Landschaft.
Adolf von Waldeck nagte an der Unterlippe. Von Edenkoben aus waren es nur noch wenige Meilen bis zur Reichsburg Trifels. Doch augenblicklich fühlte er sich so unbehaglich wie lange nicht mehr.
Der Graf hob die Schultern, als wolle er die Last der Verantwortung von sich werfen. Sein Blick schweifte zum Rand des Haardt hinüber. Die Burg, die da wie ein Adlerhorst auf einer Felsnase des Blättersbergs lag, gehörte Hermann von Rietburg.
Dem Besitzer der Burg eilte der Ruf voraus, ein übler Landplacker zu sein. Schon die Aufzählung seiner Schandtaten schmerzte in den Ohren. Bedeutsamer und bedrohlicher für den Hofrichter schien freilich die Gewissheit zu sein, dass der Ritter von Rietburg als ergebener Vasall der Staufer galt.
Sicherlich war der Rietburger durch seine Späher inzwischen vom Herannahen der Königlichen unterrichtet worden. Dass er mit seinen Burgleuten den Reiterzug überfiel, lag durchaus im Bereich des Möglichen.
Lag der Landplacker vielleicht schon auf der Lauer? Fortwährend beobachtete Adolf von Waldeck die Büsche und Baumgruppen am Wegrand, als könnten sich dort Heckenreiter versteckt halten.
Doch ringsum blieb es ruhig. Fast zu ruhig, sagte sich der Graf.
Das Unheil geschah, als der Hofrichter schon nicht mehr damit rechnete. An der Leiselbrücke bei Edesheim nahm es seinen Lauf: Waffen klirrten, Pferde stampften, wieherten, bäumten sich auf.
Vorn, hinten, an beiden Seiten des Fahrwegs tauchten Bewaffnete auf, zu Fuß und zu Pferde. Hermann von Rietburg und seine Waffenknechte umzingelten das Gefolge der Königin wie ein Rudel hungriger Wölfe ihre Beute.
Der Graf sah sich um und erkannte, dass angesichts der erdrückenden Übermacht der Raubgesellen jeder Widerstand aussichtslos war. Er war nicht nur aussichtslos, sondern selbstmörderisch.
Adolf von Waldeck zerbiss einen Fluch auf den Lippen. Irgendwie zog Wilhelms Gemahlin das Ungemach an wie Unschlittlicht die Motten. Der heutige Überfall stürzte sie nach der Feuersnot in der Hochzeitsnacht bereits in die zweite Kalamität ihres Lebens. Während des Beilagers in Braunschweig hatte eine umgefallene Kerze das Brautbett in Brand gesetzt.
Noch einmal fluchte der Hofrichter das Blaue vom Himmel herunter, dann ergab er sich dem Unvermeidlichen.
Der Schlagetot ließ Wilhelms Gemahlin samt ihrer Begleitung als Gefangene auf die Rietburg bringen. Dass er die Königin im Burgverlies eingesperrt hätte, fügten übelwollende Skribenten ihren Schilderungen über die Begebenheit hinzu. Eine solche Ungeheuerlichkeit wagte selbst Hermann von Rietburg nicht.
In Wirklichkeit quartierte der Burgherr Elisabeth von Braunschweig, ihren Sohn und die vornehmsten Begleiter in den Gästekemenaten ein. Dass er es nicht zum Äußersten kommen ließ, sollte ihm später den Kopf retten.
Was indes stimmte, war, dass die Königin dem Staudenhecht ihren Schmuck und die Geldschatulle aushändigen musste. Kurze Zeit später verließen zwei Boten das Felsennest. Einer jagte nach Worms, der andere zum Trifels. Von den Wormser Bürgern verlangte der Rietburger ein Lösegeld von 1 000 Gulden, König Wilhelm sollte für die Herausgabe seiner Gemahlin ein Vielfaches der ohnehin nicht unerheblichen Summe berappen.
Doch es kam anders, als Hermann von Rietburg sich das vorgestellt hatte. Sowohl der König als auch der Wormser Rat kerkerten die Überbringer der Lösegelderpressung kurzerhand ein. Und da der 1254 gegründete Rheinische Städtebund und einige Fürsten gleichermaßen das Hauptziel verfolgten, den Landfrieden zu erhalten, stand der Bildung eines bewaffneten Aufgebots nichts im Weg.
Binnen kürzester Zeit rückte der Heerhaufen aus, um den Landfriedensbrecher auf der Rietburg Mores zu lehren. Pfalzgraf Ludwig der Strenge, Friedrich von Leiningen, Philipp von Falkenstein, Philipp von Hohenfels, Werner von Bolanden beteiligten sich mit Reisigen und barer Münze an der Strafaktion. Die Städte Worms, Mainz und Oppenheim boten ihre Wehrbürger auf.
Den Königinnenraub büßte der Übeltäter mit der Zerstörung seiner Burg. Nachdem Hermann von Rietburg am 4. Dezember 1255 Wilhelms Gemahlin und alle anderen Gefangenen unverletzt freigelassen hatte, steckten die Verbündeten das Felsennest in Brand.
Eigentlich hätte dem Raubritter wegen der Schwere seiner Schandtaten nun der Kopf vor die Füße gelegt werden müssen. Doch die Herren von Stand fanden, er sei mit dem Verlust seiner Güter und der Vertreibung außer Landes genug bestraft.
Die Entführung einer wahrhaftigen Königin und die haarsträubende Lösegeldforderung, mit der ihr Gemahl konfrontiert worden war, sorgten für Aufsehen im Heiligen Römischen Reich. Ohne jeden Zweifel stellte der Königinnenraub sämtliche Schandtaten seit dem Beginn des Interregnums weit in den Schatten. Andererseits brachte die skandalöse Begebenheit jedoch auch die Gewissheit ans Licht, dass die anarchischen Zustände nicht nur an den Grundfesten der bestehenden Ordnung rüttelten, sondern diese über kurz oder lang zum Einsturz bringen würden.
Читать дальше