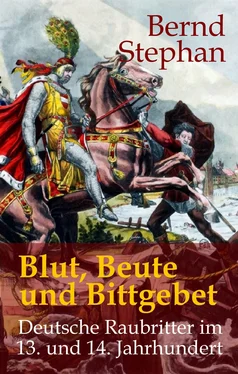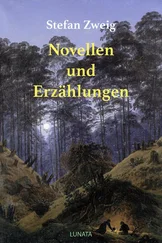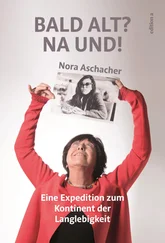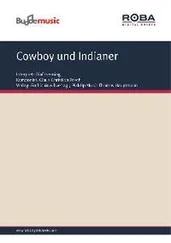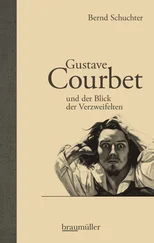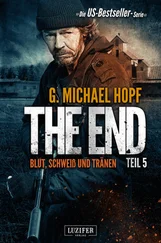Wie dem auch sei: Das Reichsgebiet versank nun im Chaos. Allerorten herrschten Wirrwarr und Durcheinander, die anarchischen Zustände wucherten wie Unkraut auf dem Feld.
Wen all dies nicht scherte, das waren die deutschen Landesfürsten. Ganz im Gegenteil, bessere Zeitläufte als die gegenwärtigen Wirren hätten sie sich nicht wünschen können. Jetzt, da es keinerlei Reichsgewalt mehr gab, streiften sie jede lehnsrechtliche Fessel ab.
Ungehemmt und zügellos trieben sie ihre Eigenständigkeit voran. Jeder Fürst ließ nur das eigene Wohl gelten. Jeder nutzte das Durcheinander aus, um seinen Landbesitz durch Aneignung von Königsgut und Reichslehen auszuweiten.
Damit nicht genug. Darüber hinaus erhoben sie Zölle und führten Abgaben jeglicher Art ein, um sich zu bereichern. Ihre Raffgier kannte keine Grenzen. Vornehmlich auf die emporstrebenden Städte und den Fernhandel lastete die landesfürstliche Willkür wie ein Albdruck.
In dem Maße, wie das Interregnum die Fürsten begünstigte, geriet der niedere Adel in Bedrängnis. Während die Landesherren Machtzuwachs erzielten, ihr Reichtum beständig wuchs und sie sich eine luxuriöse Hofhaltung leisten konnten, führte der niedere Adel ein bescheidenes Dasein. Schlimmer noch: Die Ritterschaft, welche bislang der Stützpfeiler des feudalen Heerwesens gewesen war, verarmte.
Der Ausbau der Territorialgewalt durch die Fürsten, die Ablösung der traditionellen Ritteraufgebote durch Söldnerhaufen, der Aufstieg des Stadtbürgertums, das Aufkommen neuer Waffentechniken, das Erblichwerden der Lehen, das schwindende Ansehen – alles das waren die Ursachen, weshalb es zum Niedergang des Rittertums kam.
Doch all dies geschah später, etliche Jahrzehnte später. In den Wirren der kaiserlosen Zeit bedrängte die Ritter vor allem eines: die chronische Finanznot.
Die meisten Ritter hockten als Lehensnehmer in einer Felsen- oder Wasserburg und mussten dementsprechend Zins entrichten. Den Grundzins an den Lehensherrn, den Bischofspfennig an die Kirche. Hinzu kam, dass die abzugebende Geldsumme, welche sie aufrechnen mussten, im krassen Missverhältnis zu ihren Bareinkünften stand.
Der Vasallendienst kostete ebenfalls Geld. Fortwährend musste Münzgeld aufgetrieben werden, um die Burgleute mit Pferden, Waffen, Rüstzeug und Kleidung zu versorgen. Kurzum, die Einnahmen konnten den Aufwand der ritterlichen Vasallen nicht mehr decken.
Wo aber sollten die ständig klammen Burgherren die Barmittel hernehmen? Im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts übertraf der steigende Geldbedarf der Lehensträger längst die tatsächliche Möglichkeit, sich solches zu beschaffen.
Die Hoffnung, mit dem Schwert in der Faust ins Heilige Land aufbrechen zu können und beutebeladen in die Heimat zurückzukehren, bestand nicht mehr. Der Kreuzzugsgedanke stand im Verruf, nach nahezu zwei Jahrhunderten ging die Zeit der bewaffneten Pilgerreisen ins Morgenland – welche ohnehin fast immer desaströs verlaufen waren – zu Ende.
Eine Wallfahrt in Waffen brachten dem Kreuzzügler inzwischen kaum noch die Vergebung seiner Sünden, geschweige denn Beutegut ein. Während früher aus den Händen der Heimkehrer die Gulden gehüpft waren wie Ungeziefer vom Strohsack, so drehte heute jeder Ritter den Pfennig mehrfach um.
Jeder dienstpflichtige Burgherr hatte die Kreuzzüge immer auch als passable Mühe betrachtet, die sich zunächst in Beute und später in Besitz auszahlte. Das Seelenheil und die himmlische Zukunft stand – wenn überhaupt – an zweiter Stelle.
Denn wer irgendwann selbst Eigentümer einer Grundherrschaft sein wollte, der konnte das nur über ein erbeutetes Vermögen erreichen. Kein Wunder, dass im ritterbürtigen Adel Wut und Groll gärten, als die Plünderungen in den Ländern der Sarazenen Ende des 13. Jahrhunderts zum Erliegen kamen.
Gezwungenermaßen mussten die verarmten Ritter über neue Erwerbsquellen nachdenken. Im Grunde bot ihnen die veränderte Situation zwei Möglichkeiten: Sie konnten sich entweder in einer der aufblühenden Städte oder beim Landesfürsten als Söldnerführer verdingen. Oder sie sanken zu Heckenreitern, Staudenhechten oder Stegreifrittern herab, die aus dem Sattel des Streitrosses ihren Lebensunterhalt bestritten.
Der überwiegende Teil der burgsässigen Ritter wählte den zweiten Weg. Fortan überfielen sie Reisende und verschleppten sie auf ihre Burgen, um von ihnen Lösegeld zu erpressen. Von den Kaufleuten verlangten sie Straßen- und Brückenzoll.
Wenn um ihre Burg ein Handelsweg führte oder sich diese an einem schiffbaren Fluss erhob, beanspruchten sie nach dem Aneignungsrecht die Grundruhr . Bei dieser handelte es sich um eine legitimierte Form des Eigentumerwerbs.
Sobald reisenden Handelswagen beim Passieren des Hoheitsgebietes dann einen Achsbruch erlitten und demzufolge dessen Boden berührten, verfiel die Ladung dem Grundherrn. Gleiches galt für gestrandete Schiffe.
Obschon bereits 1220 ein gesetzliches Grundruhrverbot erlassen worden war, ließen sich die Bodeneigentümer solcherart Einnahmen natürlich nicht entgehen. Sie missachteten das Verbot nicht nur, sondern setzten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein, um die Einkünfte zu erhöhen. Ihre unredlichen Übergriffe kannten keine Schranken.
(03) Interregnum: In „der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit“ lauerten Raubritter überall im Heiligen Römischen Reich. Vorüberziehende Kaufleute überfielen sie im Wald oder an einer Flussfurt.
Neben dem Missbrauch des Grundruhrrechts raubten die Burgherren die benachbarten Dörfer aus und verschonten auch kirchliche Einrichtungen und Besitzungen nicht. Nebenbuhlern setzten sie den roten Hahn aufs Burgdach.
Zeitgenössische Annalenschreiber bezeichneten die Wegelagerer, Plünderer und Mordbrenner als Landplacker. Ab Ende des 18. Jahrhunderts kam schließlich jene Etikettierung auf, die vielen Historikern ein Gräuel ist – jetzt hießen sie Raubritter. Trotz allem trifft der Begriff Raubrittertum das Phänomen einer seit Mitte des 13. Jahrhunderts dem Verfall preisgegebenen Adelsschicht, der Gewaltanwendung als Mittel zur Selbstbehauptung dient, rational im Kern ...
Der Raub der Königin
Je unergiebiger die Einnahmequellen der Ritter im Interregnum sprudelten, desto übler überzogen sie das Land mit Mord, Unheil und Brand. Die Raubritter wurden zur Landplage.
Schlimmeres hätte nicht passieren können. Der Konflikt um das römische Kaisertum schwelte, die Landesfürsten befehdeten einander um das letzten Königsgut. Und nun brach auch noch wie eine alles vernichtende Woge das ritterliche Raubgesindel über das wehrlose Land herein. Tag für Tag streunten irgendwelche Burgherren mit ihren Bewaffneten durch das Land, um wie ein Rudel hungriger Wölfe in die Dörfer einzudringen, lechzend nach Blut und Beute.
Die Unholde nahmen mit, was nicht niet- und nagelfest war. Kessel, Töpfe, Pokale und Tiegel aus Kupfer, und falls sie derlei aufstöberten, Löffel und Leuchter aus Silber. Das metallische Beutegut schmolzen die Burgschmiede ein und schlugen Münzen daraus.
Vorräte an Speisen und Getränke brauchten die Raubgesellen immer, das Getier in den Burgställen verlangte nach Heu und Hafer. Und wenn es alles dies nicht zu holen gab, verschmähten die Plünderer selbst Wandbehänge, Bettzeug, Körbe und eisenbeschlagene Truhen nicht.
Das Federvieh schlachteten sie an Ort und Stelle, das Großvieh trieben sie fort.
Was half es, wenn ein Dörfler sich wehrte. Wer sich den Raubgesellen in den Weg stellte, wurde niedergehauen. Überhaupt: Wenn den Halunken etwas verquer ging, verschonten sie keinen der Dorfbewohner. Keinen Greis, keinen Mann, keinen Säugling. Über die Mädchen und jungen Frauen fielen sie her, bevor sie ihnen die Kehle durchschnitten.
Gelegentlich verschleppten sie die weiblichen Geschöpfe auch. Meist solche, die hübsch waren und über schwellende Körperformen verfügten. In den Burgen würden sie dann ihr Leben als Stallmägde und Huren fristen, und zwar so lange, bis ihre Gesundheit ruiniert war. Zu guter Letzt prügelte man sie aus dem Raubnest wie räudige Hunde. Überflüssige Fresser konnte sich der Burgherr nicht leisten.
Читать дальше