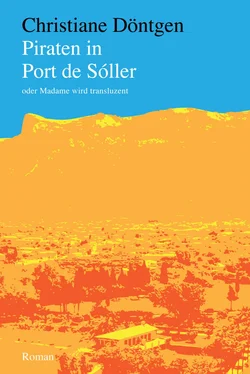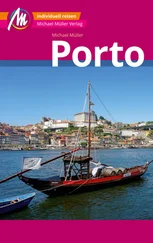Christiane Döntgen
Piraten in Port de Sóller
oder
Madame wird transluzent
Roman
Imprint:
Piraten in Port de Sóller oder Madame wird transluzent
Christiane Döntgen
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
Copyright: © 2012 Christiane Döntgen
ISBN 978-3-8442-4117-4
Lektorat: Melanie Quade
Umschlaggestaltung: Nicole Schönbeck
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Alle Rechte vorbehalten.
Montag, 7. Mai 2012
»Sie haben es genommen«, flüsterte er und schüttelte den Kopf.
Regina war gerade erst zurückgekommen. Sie trug eine alte Jeans, das T-Shirt zeigte deutliche Spuren ihrer Arbeit. Ihre Haare waren inzwischen wieder so lang, dass sie sie zu einem Zopf binden musste, damit sie ihr nicht dauernd ins Gesicht fielen. Seitdem sie die Orantique, eine Kreuzung aus Orange und Mandarine, ernteten, war die Nachfrage sprunghaft gestiegen. Sie hatte alleine an diesem Nachmittag acht neue Kunden beliefert und war völlig erschöpft vom Kistenschleppen.
Ihr Mann starrte sie mit weit geöffneten Augen an.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Sie nehmen es. Alfaguara, Madrid. Weißt Du, was das heißt?«
Vor ihr stand ein Mann, so groß, dass er sich unter den Türrahmen des alten Hauses bücken musste, und wirkte in seiner Fassungslosigkeit wie ein kleines Kind.
»Gerade haben sie angerufen. Natürlich haben sie noch Änderungswünsche. Aber sie nehmen es.«
Für ihn waren die letzten Monate anstrengend gewesen, auch wenn er immer wieder betont hatte, wie leicht ihm alles fiel. Er hatte das Haus umgebaut und zugleich sein erstes Buch geschrieben. Eigentlich war es ihnen schon viel zu gut gegangen in ihrer Zufriedenheit mit dem Leben. Regina misstraute diesem Zu-stand zutiefst. Es gab kein großes Glück, dessen war sie gewiss. Doch heute ging das, was es nicht gab, in seine nächste Runde.
»Wir müssen feiern«, sagte Regina. »Lass uns alle anrufen, damit sie herkommen und es hören. Gib mir zehn Minuten, dann bin ich schon soweit. Haben wir noch genug zu trinken im Haus? Vor allem Rotwein und Bier.« Sie stockte kurz, legte den Zeigefinger auf ihre Lippen und dachte nach. »Aber nein, das geht ja nicht, wenn alle dabei sein sollen. Gehen wir zum Hotel feiern .«
Er lächelte und ließ sich in einen kleinen Korbstuhl fallen, der im Flur hinter der Eingangstüre stand. Dort saß er noch, als Regina in einem bunten Kleid wiederkam.
»Alles klar. Wir gehen. Komm schon, Araber, das ist Dein Tag«, sagte sie und küsste ihn auf den blanken Kopf. Er kam zu sich, stand auf.
»Ja, heute wollen wir feiern.« Gemeinsam machten sie sich auf den Weg die Straße hinunter zu dem kleinen, leicht verfallenen Hotel mit traumhaftem Blick über die Bucht.
Sonntag, 9. Mai 2010
Madame Zigurés erster Blick auf ihre Gäste ging über den Rand ihrer Brille und den Tresen vor ihr direkt unter das Kinn der Neuankömmlinge. Sie hatte sich angewöhnt, erst dann aufzusehen, wenn wirklich jemand vor ihr stand. Jedem entgegenzuschauen hielt sie von der Arbeit ab und war ein zweckloses Unterfangen: Die Rezeption war in die freie Nische zwischen Aufzugschacht und Speisesaal eingefasst. Von hier aus konnte man den Eingang nur erkennen, wenn man sich aufrecht hinstellte und nach rechts über die kleine Regalfläche reckte. Von dort spähte man zwischen zwei der dicken Holzstreben hindurch, die den Speisesaal und die Eingangshalle von der Rezeption trennten. Das kostete unnötig Zeit. Madame wartete, bis die Gäste zu ihr kamen. Ihnen blieb ohnehin nichts anderes übrig.
So lernte Madame Ziguré jeden Gast zunächst als Brustbild kennen und schaute dann kurz in sein Gesicht – was ihr zur Klassifizierung in der Regel vollkommen genügte. Nach fast 35 Jahren im Hotelgewerbe – die meisten davon in ihrem eigenen Betrieb – lag sie nur selten daneben. Um in dem für die Branche üblichen Bewertungssystem zu bleiben, vergab sie für ihre Gäste Sterne. Ihr Hotel mit 46 Zimmern hatte es zu zwei Sternen der Landeskategorie gebracht. Ihre weniger anspruchslosen Gäste konnten nur ahnen, was dies für Ein-Stern-Häuser bedeutete; sie würden es aber unter keinen Umständen erleben wollen. Ein bisschen Schimmel am Duschvorhang, Staubwollmäuse am Boden, die flink durchs Zimmer huschten, wenn man Tür oder Fenster öffnete, ein Haar des Vorgängers im Abfluss der Dusche, Staub auf den Schrankeinlegeböden (soweit diese überhaupt vorhanden waren), Zigarettenasche hier und da – all das zeichnete die Landeskategorie »Zwei Sterne« in diesem Haus aus. »Ein Stern« wurde wahrscheinlich niemals vergeben – und wenn doch, dann nur an solche Häuser, vor denen man warnen wollte.
Auch bei den Gästen waren diejenigen mit nur einem Stern natürlich die Schlimmsten. Menschen dieser Ziguréschen Kategorie waren sehr, sehr ordentlich. Sie beschrieben ihren Anspruch an ein anständig geführtes Hotel mit den Worten »Hauptsache sauber« und stuften sich damit in ihrer Selbsteinschätzung als höchst anspruchslos ein. Alles andere war ihnen völlig egal: nur bitte eben keine Haare im Abfluss und kein Staub auf den Schränken. Hauptsache-sauber-Gäste waren Querulanten und als solche zu behandeln. Madame erkannte sie auf den ersten Blick und schickte sie in ihre unangenehmsten Zimmer. Kaum hatten sie den Weg dorthin angetreten, wettete Madame mit sich selbst, wann Herr oder Frau Sauber oder am besten beide samt Gepäck wieder Brust aufwärts vor ihr am Tresen erscheinen würden. Mit etwas Glück war das erst nach einer Nacht der Fall und sie konnte ihnen eine Reinigungsgebühr für den ungeplanten Zimmerwechsel berechnen. Was erwarteten sie denn für den besten Preis in der ganzen Bucht? Ein Burj al Arab wie in Dubai? Mit sechs Bediensteten pro Suite, die andauernd die Handtücher wechselten und die Gäste zum Privatstrand kutschierten, wo nicht nur das Meer, sondern gleich auch geeiste Tücher für Erfrischung sorgten? Fünf-Sterne-Gäste waren das genaue Gegenteil, ein Traum für Madame, kamen allerdings so gut wie nicht vor. Sie waren freundlich, hatten nichts Überflüssiges, weder in ihrer Kommunikation noch bei ihren Wünschen, nahmen alles so, wie es kam. Solche Gäste gaben Gabriella am Ende des Urlaubs ein ordentliches Trinkgeld fürs Putzen, obwohl sie fast täglich die Zigarettenasche des fünfundsechzigjährigen Zimmermädchens irgendwo im Raum gefunden hatten.
Madame Ziguré hatte ihren Beruf in Nizza gelernt. Dort war sie geboren und aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung in einem kleinen Hotel hatte sie das Weite gesucht. Gefunden hatte sie es im Mittelmeer auf der Insel Mallorca in einem kleinen, verschlafenen Hafen im Nordwesten. Das erste Hotel am Platz – das Marisol – hatte gerade eröffnet und war auf der Suche nach qualifiziertem Personal gewesen, das man in dieser Zeit am besten auf dem Festland rekrutierte. Die Inselbewohner hatten sich damals noch wie zu Zeiten Georges Sands verhalten, die den Menschenschlag als schlicht unzivilisiert, unhöflich und unerträglich empfunden hatte. Ein Missverständnis, denn sie wollten einfach nur in Ruhe gelassen werden. Sie waren nicht geboren, um zu dienen – wenigstens nicht im 19. Jahrhundert. Und im zwanzigsten, als aus dem Dienen Service geworden war, hatten die Hoteliers an den entscheidenden Stellen im Kontakt mit den Gästen zunächst Personal aus den großen Tourismuszentren bevorzugt – vor allem solches, das neben Spanisch eine weitere Sprache beherrschte.
Von Anfang an hatten sich die Urlauber auf der Insel als sprachfaul erwiesen. Madame hatte hierfür ihre ganz eigene Erklärung entwickelt: Wenn man schon in einem Land Urlaub machte, das von einem Diktator regiert wurde – so unterstellte sie den deutschen Urlaubern von damals – sollte man die Sprache ebenso ignorieren wie die politischen Verhältnisse. Als General Franco dann 1975 durch sein Ableben den Weg für die königliche Demokratie freimachte, hatten sich die Touristen offensichtlich schon daran gewöhnt, verstanden zu werden. Mit der Autonomie der Balearen wurde dann das Mallorquí als regionale Sprache gefördert – und die Urlauber natürlich gänzlich überfordert.
Читать дальше