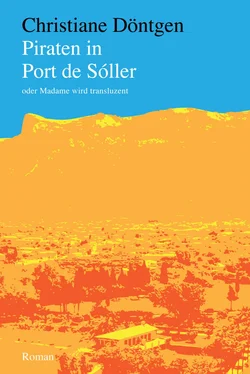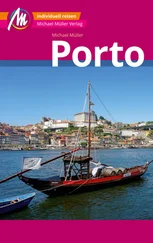Die robuste, aber keineswegs übergewichtige Hotel-Chefin schaute zufrieden auf ihren Buchungsplan. Wenn sie lächelte, erinnerte ihr Gesicht ein wenig an das eines fülligen Hamsters. Sie war fast glücklich mit ihrem Leben und mit ihrem Hotel – das eigentlich ihrem Mann Jesús gehört hatte und ihre gemeinsame Tochter später einmal erben würde.
Jesús war nicht etwa gestorben, sondern hatte das Hotel auf seine Frau überschrieben, um es dem Zugriff seiner Familie zu entziehen. Nach dem Tod seines Onkels war das Haus Anfang der 1970er Jahre in seinen Besitz übergegangen – samt der auf der anderen Straßenseite liegenden Terrasse, die einen herrlichen Blick über die Bucht bot. Jesús war sein Lieblingsneffe gewesen und überdies wie sein Onkel kein Freund von Francos Regierung. Ein Rechtsstreit um das Erbe begann, der erst ein paar Jahre nach dem Tod des Onkels endete. Jesús Maria Mendez war zu seinem Recht gekommen, wollte aber nichts mehr riskieren, heiratete seine erste und große Liebe, überschrieb ihr das Borrasca und sein Leben. Kennengelernt hatte Madame ihn im Marisol, dort hatte er im gleichen Jahr wie sie als Kellner angefangen. Damals war er zwar schon selbst Hotelbesitzer gewesen, hatte den Beruf aber noch nicht ausüben können. So war ihm erst einmal nichts anderes übrig geblieben, als zu üben. Für ihn war es ein großes Glück gewesen, sonst hätte er Mademoiselle Eleonore Ziguré vielleicht niemals getroffen, und alles wäre ganz anders gekommen.
Madame sprach neben Französisch auch Spanisch, Mallorquí, Englisch und Deutsch, zwar nicht unbedingt perfekt, aber für die Kommunikation mit ihren Gästen reichte es. Wie es bei Fremdsprachen oft der Fall ist, konnte sie diese besser verstehen als sprechen. Sie begrüßte die Gäste gerne in ihrer jeweiligen Sprache und mit den immer gleichen Worten. Nach so langer Zeit waren die Sätze eingeschliffen und die Worte für ungeübte Zuhörer schwer voneinander zu trennen. Aus dem Französischen war Madame es gewohnt, die Silben über Wortgrenzen hinweg einfach zusammenzuziehen, was sie dann auch in den anderen Sprachen tat. Das klang im Deutschen dann so:
»Gutentack, willkommenimborrasca.«
Die Gäste nestelten ihr Hotel-Voucher und ihre Pässe aus taschendiebsicheren Brustbeuteln und legten sie auf den Tresen. Madame räumte alles ab wie ein Croupier beim Roulette, wenn das Spiel gelaufen und ab sofort nichts mehr zu gewinnen ist.
»Donkeschön.« Die Melodie ging am Ende des Wortes steil nach oben und Madame schaute in erwartungsfrohe Gesichter, die glaubten, nun folgten wichtige Informationen in Form einer Aufzählung. Und sie hatten recht:
»ZimmervierhundertsechszöhnmitMeerblick.SiebenUhrfümfundvierzieschbisneunUhrdreissieschFrühstück.NeunzöhnUhrdreissieschbiseinundzwanzieschUhrdreissieschAbendessen.SiekönnentrinkenonderBar.MitmirmitdemNachtportierzumEssenimmer. Getränkesindimmer – Cash.«
Vor dem letzten Wort machte sie eine kurze Pause und senkte zum ersten Mal wieder ihre Stimme. Der Zuhörer wusste: Hier war Bedeutendes gesagt worden. Er hatte es nur nicht verstanden. Denn er brachte das Wort »Cash« einfach nicht in Zusammenhang mit dem vorher Gesagten.
Dabei hatte Madame es sich angewöhnt, das Wort deutlich aus-zusprechen. Ganz deutlich. Ein universelles Wort, das man überall auf der Welt kannte, da war sie sicher. Sie hatte geübt, ihren Redefluss zu unterbrechen und »Cash« wie einen Schlussakkord ans Ende zu setzen. Und trotzdem: Bei der ersten Getränkebestellung zum Abendessen schauten sie neunzig Prozent ihrer deutschen Gäste mit großen Augen an, wenn sie sofort zahlen mussten. Aufs Zimmer schreiben gab es im Hotel Borrasca nicht.
»IhrZimmeristvierhundertsechzöhn.HieristderSchlüssel.Da-istderAufzug.« – Ihre Kopfbewegung zeigte zu einer roten, schmalen Aufzugtür auf der linken Seite des kurzen Flures. Die Köpfe der Gäste drehten sich schnell in die Richtung, um den schwer verständlichen Worten durch ein Bild einen Sinn zu geben. Zum Zimmer begleitet wurden sie nicht, es sei denn, sie erwiesen sich als hilfsbedürftig, was bei einem von Wanderern und sparsamen Menschen bevorzugten Hotel selten vorkam. (Lediglich Behindertengruppen genossen im Borrasca Privilegien: Man kümmerte sich um sie.)
Ansonsten beschränkte Madame den Kontakt zu den Gästen auf das Nötigste. Dazu zählten natürlich, auf eine Frage zu antworten, sich für Lob zu bedanken oder eine zweite Scheibe Brot aus der Küche zu holen – letzteres mit einem Gesicht, das diesen Wunsch kein zweites Mal aufkommen lassen würde. Bestellte jemand einen Kaffee nach dem Essen war auch ein wenig Smalltalk möglich, die Betonung auf der ersten Silbe des Wortes. Die Gäste freuten sich über jedes Lächeln von Madame, sie sehnten sich nach ein paar Tagen regelrecht danach, denn sie verteilte es wohl dosiert und vornehmlich, nachdem für irgendein Getränk wieder »Cash« geflossen war.
Vor Madame Ziguré baute sich nun ein neues Brustbild auf. Bestimmt die Zehn-Uhr-Maschine aus Deutschland, eine der unzähligen Zehn-Uhr-Maschinen aus Deutschland. In der Hauptsaison hatte die Ankunft aus dem bevölkerungsreichsten Land der EU etwas von einer Evakuierung. Alle raus!
Doch vor ihr stand kein fröhliches, rotwangiges Urlauber-Paar, deren Mitgliedschaft im Alpenverein eine Anstecknadel auf dem karierten Hemd dokumentierte; seit sie ein Wanderer-Hotel führte, hatte sie das kleine Edelweiß unzählige Male gesehen. Das Brustbild vor ihr gehörte zu einem alten Mann. Er musste doch jetzt schon bald 80 sein. Oder darüber? Nein. Madame ließ einen leichten Seufzer vernehmen, eine sehr kleine Entgleisung angesichts der Tatsache, dass sie gerade eine neue schlimmste Sternekategorie für Gäste eröffnen musste: Verwandte.
Dabei war sie extra weit von zu Hause weggegangen. Über das Mittelmeer kam man nicht mal eben so auf einen Sprung vorbei. So sollte es sein. Sie hatte ihn vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen. Aus Versehen. Bei einer Beerdigung. Jetzt stand er da und starrte sie an, ließ den Blick über ihre grauen, kurzen Haare, ihren Pony, ihre modische Brille aus transluzentem, weißem Kunststoff bis zu ihrem Dekolleté wandern und nickte kaum merklich. Madame verdrehte die Augen und fragte ganz ruhig: »Was willst Du?«
»Ein Zimmer?«, fragte er vorsichtig zurück.
»Vergiss es!«, flüsterte Madame. »Alles belegt. Es ist Mai. Der beliebteste Wandermonat überhaupt. Außerdem haben wir Wanderarbeiter im Haus, vom Hotelneubau auf der anderen Seite der Bucht. Wir sind ausgebucht.«
Sie senkte den Blick auf die Tastatur ihres Laptops, tippte etwas und schaute dann durch den unteren Bereich der Brillengläser auf das Display, wofür sie den Kopf ein wenig in den Nacken legen musste. Und außerdem, dachte sie, außerdem haben wir kein Zimmer für Null-Sterne-Gäste.
»Ich brauche nicht viel Platz. Nur ein Bett.«
Madame tippte, blickte auf das Display und tippte weiter.
»Nur für ein, zwei Nächte. Bitte, Eli.«
Die Luft entwich aus ihrer Nase wie aus einem Kessel, in dem der Druck langsam stieg. Dabei bemühte sie sich nach Kräften, einen eiskalten Wind durch den Raum wehen zu lassen. Wie immer stand er ratlos da und blickte sie aus traurigen Augen an, die um eine Erklärung bettelten. Eine Erklärung dafür, warum sie ihre Eltern einfach so in Nizza zurückgelassen und sich nie gemeldet hatte. Sie sah ihm an, dass er die Schuld dafür bei sich suchte und ihn sein Gewissen quälte. Doch sie konnte ihm nicht helfen.
Madame hatte sich nie etwas aus ihren Eltern gemacht, sie waren ihr egal. Natürlich wusste sie, dass es bei den meisten Menschen auf der Welt anders war. Als sie jung war, hatte sie darunter gelitten. Während andere in ihrem Alter sich an den Erwachsenen rieben, sich mit ihnen überwarfen und wieder versöhnten, um dann gleich wieder den nächsten Familienkrach vom Zaun zu brechen, lebte Eleonore mit zwei Menschen, die zufällig älter waren als sie, in einer Wohngemeinschaft. Mehr war ihr einfach nicht möglich gewesen.
Читать дальше