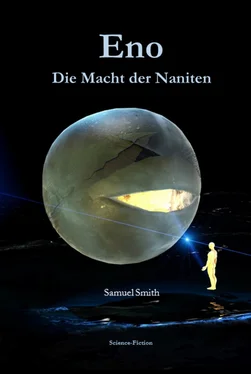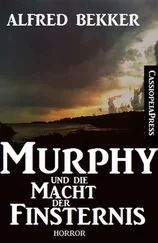Eno spürte einen dicken Kloß im Hals und alles erschien ihm plötzlich unwirklich. Die Brüder starrten ihn erstaunt an, vielleicht zum ersten Mal richtig, denn sie musterten unwillkürlich Enos blonde Haare, die blauen Augen und die kleine, fast zierliche Gestalt. Walter und Karl hatten beide dichtes schwarzes Haar und braune Augen wie ihre Mutter. Die Unterschiede waren eigentlich nicht zu übersehen, doch erst jetzt begriffen sie, dass Eno nicht ihr leiblicher Bruder war. Nach all der Zeit, die sie zusammen verbracht hatten, unvorstellbar. Mutter stand wortlos auf und stellte sich hinter Eno. Sie schlang zärtlich ihre Arme um ihn, zog ihn an ihre Brust und küsste ihn auf den Kopf. Dann hauchte sie mit erstickter Stimme: „Eno, du bist unser Sohn und wir haben dich alle sehr lieb. Du gehörst zu uns, und das soll auch immer so bleiben. Vater und ich haben aber beschlossen, dass du die Wahrheit kennen sollst.“ Sie löste sich fast widerwillig von Eno, trat zurück und setzte sich wieder an den Tisch. Niemand sagte etwas. Die Brüder waren einfach zu verblüfft und schauten hilfesuchend ihren Vater an, darauf wartend, dass dieser böse Scherz schnell ein Ende finden würde. Eno aber vergaß für eine Weile zu atmen und tat es dann umso öfter, sodass man ihn angestrengt keuchen hörte. Endlich war es Vater, der das Schweigen durchschnitt wie ein scharfes Schwert. Er sprach einfach das Dankgebet, als ob alles wie früher wäre, und wie immer fassten sich alle mechanisch an den Händen, froh irgendetwas zu tun. Aber es war nicht wie immer. Schon gar nicht für Eno. Enos Gedanken wirbelten wild durcheinander wie trockenes Laub, und obwohl er überrascht sein sollte, war er es nicht. Tief im Innern schien er es immer geahnt zu haben. Doch sobald er versuchte, den Gedanken an seine Vergangenheit festzuhalten, entglitt er ihm wieder wie ein glitschiger Fisch, den man mit den Händen aus dem Wasser ziehen wollte. Als Vater geendet hatte, hielt Eno immer noch die Hände seiner Brüder, und da niemand zuerst loslassen wollte, blieben alle sitzen und blickten Eno abwartend an. Endlich bemerkte Eno die Blicke und ließ die Hände erschrocken los, als wenn sie plötzlich zu heiß geworden wären. Er stand fluchtartig auf, brummelte etwas von wegen alleine sein und rannte aus dem Haus. Die Mutter und seine Brüder wollten ihm nachgehen, aber Vater hielt sie mit einer entschiedenen Handbewegung zurück.
Eno spürte den einsetzenden Regen nicht, der unablässig auf ihn nieder trommelte und noch um einiges stärker geworden war. Er merkte auch nicht, wohin er ging, bis er sich auf dem Feld wiederfand, von dem Vater erzählt hatte. Etwas in seinem Inneren wusste plötzlich, dass es hier gewesen war, wo seine Eltern ihn gefunden hatten. Einem Instinkt folgend richtete er seinen Blick zum Himmel. Der Regen hatte aufgehört und obwohl am Nachthimmel dunkle Wolken hingen, war wie durch ein Wunder ein kleines Stück Sternenhimmel zu sehen. Nicht viel, aber es schien ihm, als wenn ein Licht dort oben heller leuchtete als alle Sterne, die er je gesehen hatte. Sicher waren es nur seine überreizten Nerven, die ihm etwas vorgaukelten. Spät nachts lief er frierend, müde und völlig durchnässt nach Hause. Seine Brüder schliefen schon, doch seine Eltern hatten noch auf ihn gewartet. Sie umarmten ihn so, als ob er eben erst von einer langen Reise zurückgekommen wäre. Mutter hatte eine warme Decke gebracht und Vater schürte das Feuer im Kamin, das mittlerweile völlig heruntergebrannt war. Dann sagte der Vater sanft und in seinen Augen leuchtete es: „Ich wollte dir eigentlich die Sachen morgen geben, aber vielleicht ist gerade jetzt der beste Augenblick dafür. Er bückte sich und verschwand durch die niedrige Seitentür in die Scheune, die direkt neben dem Haus lag. Eno konnte ihn in der alten großen Truhe kramen hören, die immer abgeschlossen war. Als er nach kurzer Zeit zurückkam, hatte er einen Stab aus Holz dabei. In der anderen Hand hielt er ein Tuch. Es konnte aber auch eine alte Windel sein, dachte Eno bei sich. Er reichte Eno den Stab und das Tuch mit den Worten: „Das haben wir bei dir in der Nacht vor achtzehn Jahren gefunden, als wir dich fanden.“ Dann fasste er unter sein Gewand und holte eine filigran gearbeitete Metallkette heraus. Sie bestand aus vielen kleinen Ringen und hatte eine mattgraue Farbe, die an minderwertiges Eisen erinnerte. Die Kette besaß keinen Verschluss und man musste sie über den Kopf streifen. Vaters Stimme schien für Eno wie aus weiter Ferne zu kommen: „Diese Kette war um deinen Körper gewickelt. Ich habe versucht herauszufinden, ob es sich bei diesen Dingen um etwas Besonderes handelte. Der Stab und das Tuch sind nichts wert und für die Kette bekommt man höchstens einen Kupferling beim Händler in der Stadt. Es wurde mir versichert, dass es um eine simple wertlose Eisenkette handelt, die niemand je tragen würde, so hässlich ist sie. Es tut mir leid, aber das ist alles, was deine wahren Eltern dir mitgegeben haben. Wir wissen nicht, warum du bei uns bist, aber wir wissen, dass du zu uns gehörst, für immer.“ Mit diesen Worten legte er Eno die Kette um den Hals. Sie fühlte sich erstaunlich leicht an, und man spürte sie kaum beim Tragen. Dann nahm Eno den etwa anderthalb Meter langen Stab aus dunklem poliertem Holz. Er war glatt und makellos, keine Einkerbung, kein noch so kleines Astloch war auf dem fast schwarzen Holz zu sehen. Obwohl der Stab schwer aussah, war er unnatürlich leicht und lag gut in der Hand. Zuletzt nahm Eno das Tuch. Es war ein festes grobes Leinentuch, das bei näherem Betrachten wie eine Windel aussah und wahrscheinlich auch eine war. Ausgebreitet war das Tuch erstaunlich groß und man konnte sich darin einwickeln, wenn man denn wollte. Eno wollte nicht. Er bedankte sich bei seinen Eltern für die Aufbewahrung der Sachen, nahm fast behutsam seine neuen Besitztümer und verschwand in seinem Zimmer. Er wollte alleine sein und seine Eltern verstanden das. Eno legte sich in sein Bett und glitt erst nach geraumer Zeit in einen unruhigen Schlaf. Er träumte von dunklen Ungeheuern, die ihn verfolgten, und wie er weit weg von zu Hause in einem fernen Land weilte und Dinge sah, die kein Mensch zuvor gesehen hatte. Plötzlich wurde er von einem finsteren Schattenwesen angegriffen. Er rang mit ihm und gerade als seine Sinne zu schwinden drohten, wachte er auf und sah Mutter an seinem Bett knien, in der rechten Hand eine Öllampe haltend. Sie streichelte ihm das Gesicht, lächelte verständnisvoll und schob eine widerspenstige Haarsträhne aus seiner schweißnassen Stirn. „Bist du wach, mein Sohn?“ Eno, der ins Licht der Lampe blinzelte und froh war, dem Albtraum entkommen zu sein, nickte nur. „Ich muss dir noch etwas sagen mein Junge“, flüsterte die Mutter. „Wann warst du das letzte Mal krank?“ Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern fuhr fort „Du weißt es nicht, kannst dich nicht erinnern? Es ist wahr. Du bist immer gesund gewesen, solange ich zurückblicken kann. Nicht einmal einen Schnupfen hattest du wie deine Brüder. Vielleicht war es das, was dir deine Eltern wirklich mitgegeben haben. Eine strotzende Gesundheit, um die dich jeder beneidet. Ich hab gewartet, bis alle schliefen, um dir das zu sagen. Es macht dich zu etwas Besonderem, und das ist in einer Zeit, wo man schnell als Hexer oder Schlimmeres verschrien oder sogar verurteilt werden kann, nicht gut. Behalte es also für dich. Wir lieben dich alle, so wie du bist. Gute Nacht und schlaf schön. Möge Gott dich segnen.“ Sie küsste Eno auf die Stirn und verließ leise das Zimmer. Enos Augen brannten plötzlich und heiße Tränen rannen ihm übers Gesicht. Er fuhr sich mit dem Handrücken über die nassen Augen und lag noch lange wach in dieser seiner Nacht, die Nacht vor seinem achtzehnten Geburtstag. Nun war etwas anderes daraus geworden und obwohl vieles von dem Gehörten ihn nicht wirklich überrascht hatte, war es doch ein Unterschied, nur zu ahnen oder wirklich zu wissen. Vielleicht war zu viel Kenntnis gar nicht so gut, wie Eno immer geglaubt hatte. Er verdrängte die dunklen Gedanken mit aller Macht, und erst viel später fiel er in einen unruhigen Schlaf. Hätte er zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit geahnt, wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber Ahnung und Wissen machen oft den Unterschied aus, ob jemand sich aufmacht. Gewissheit zu finden, dabei Risiken eingeht und sich selbst dabei findet oder das Wissen einfach annimmt und letztlich nichts damit anzufangen weiß, und es nichts mehr gibt, wofür der Einsatz lohnt. Eno hatte eine Ahnung in sich, was das alles bedeuten könnte, aber er war weit davon entfernt, sich deshalb aufzumachen, um die Wahrheit zu finden. Aber die Wahrheit sollte ihn finden.
Читать дальше