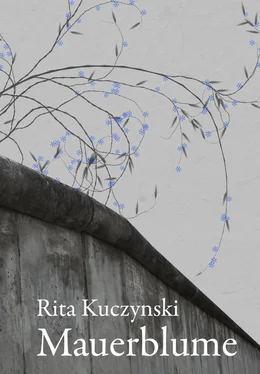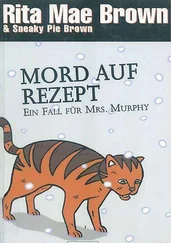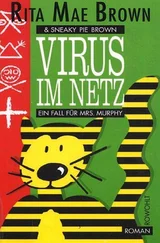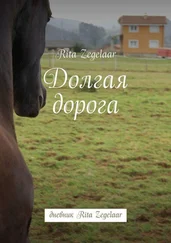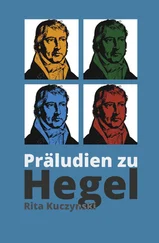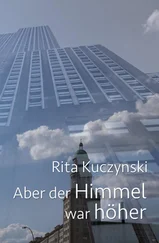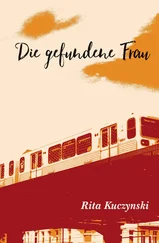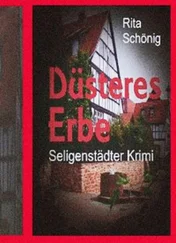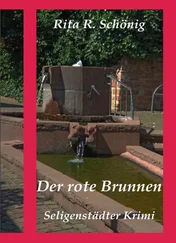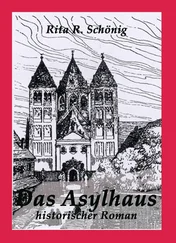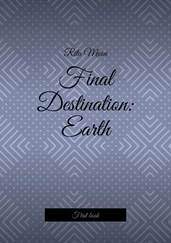Als Verkäuferin in einer privaten Fleischerei hatte ich mein erstes ordentliches Arbeitsverhältnis im Arbeiter-und Bauern-Staat.
Nachdem ich durch Rindfleisch und Koteletts tatsächlich wieder zu Kräften gekommen war, ging mir der Winter und meine Arbeit in der Fleischerei bald derart auf die Nerven, daß ich Depressionen bekam. “Hundert Gramm Jagdwurst, 100 Gramm Leberwurst und 150 Gramm Thüringer im Stück.” - “Rinderfilet haben wir nicht.” In Gedanken: Jedenfalls nicht für Sie. “Aber Kaßlerrippchen haben wir, die sind sehr schön. Fragen Sie mal Freitag nach. Freitag kommt neue Ware. Vielleicht ist da etwas dabei...” Das tägliche Einerlei. Immer die gleichen Handgriffe, Gespräche, die gleichen Kunden und Kommentare der Verkäuferinnen. Was ging mich das an? Das konnte nicht das Leben sein, jedenfalls nicht für mich.
Aber ich weigerte mich, mich mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen, in denen ich lebte. Ich lief, als hätte ich selbst eine Decke über mich geworfen, die mich unsichtbar machte, auch vor mir selbst. Es war eine Art Dämmerzustand, in den ich gefallen war. Ich wollte nichts wissen von der DDR, von Politik und vom sozialistischen Tralala. Ich las auch keine Zeitung in jener Zeit. Die Zeitungssprache erzeugte Brechreiz in mir.
Meine eigene Leere machte mir sehr viel Angst. Mit dieser Angst nahm ich eines Tages all die Pillen, die mir die Psychiater über Monate verschrieben hatten und die ich nicht genommen, wohl aber gesammelt hatte. Ich wachte in einem Krankenhaus auf. Die Station, auf der ich lag, hieß Reanimation. Mein Bett war umstellt von blauen Sauerstoffflaschen. Ich fühlte mich elend und war wütend auf die Ärzte und Schwestern, die um mein Leben kämpften, wie sie sagten. Was ging sie mein Leben an? Ich wollte es beenden, und sie hatten kein Recht, sich da einzumischen.
Als ich aus der Klinik entlassen wurde, hatte ich wieder keine Wohnung. Auf den Spaziergängen durch die Klinik aber hatte ich die Aushänge gelesen: “Suchen Krankenschwestern und Hilfsschwestern. Unterkunft im Schwesternwohnheim möglich.” Ich ging zur Personalabteilung und bewarb mich. Zwei Tage später fing ich auf einer chirurgischen Station als Hilfsschwester an. Ich trug Essen auf und ab, lernte Betten bauen und Steckbecken desinfizieren. Bald hatte ich gelernt, was zu lernen war als Hilfsschwester.
Wieder war da diese Leere in meinem Kopf und die Angst. Ich versuchte ein zweites Mal, mich umzubringen. Als ich in der Reanimation aufwachte, die gleichen Ärzte und Schwestern an meinem Bett sah, die mich “ins Leben” zurückgeholt hatten, schwor ich mir bei den blauen Sauerstoffflaschen an meinem Bett, hier nicht noch einmal zu landen. Nicht nur, weil ich auch hier in der medizinischen Reihenfolge der Wiederbelebungsmaßnahmen Routine befürchtete. Ich verstand, wenn auch nur undeutlich, daß ich nicht wirklich sterben wollte. Die Sinnfrage allen Lebens und Seins stellte sich zum ersten Mal mit großer Heftigkeit ein. Mit ungeheuerem Eifer ging ich ihrem WARUM, WESHALB, WOZU bald nach, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen.
Ich zog zu Alex. Ich hatte ihn in einer Nachtbar kennengelernt. Ich suchte sie ab und zu auf, wenn ich nicht schlafen konnte, weil meine diffusen Nachtängste so groß wurden.
Alex träumte von Motorrädern, Autos, von raffinierten Plattenspielern und modernen Radios. Alex dachte sehr konkret und bastelte immer an irgend einem Motor oder an einem Radio. Er war Elektroingenieur. Mit meinen abstrakten und lyrischen Sinnfragen konnte er nichts anfangen. Er liebte den Wald, nicht Eichendorffs Gedichte über den Wald. Wir zelteten viel und segelten. Er nahm mich mit in den Segelclub, den er über die Betriebsgewerkschaft nutzen konnte. Alex führte mich zurück in die Natur: zum Pilzesammeln - Pilzetrocknen, zum Beerensammeln - Marmeladekochen. Vorräte schaffen für den Winter. Wenn ich ihn fragte, für welchen Winter, wir seien doch schon tief in ihm, sah er mich verständnislos an. Alex war gut zu mir. Für große Liebe fehlte es mir an Kraft. Aber daß ich nicht mehr alleine war, auch nachts, wenn die Angst aufstand und mich mitnahm auf ihrem Schrei, daß ich mich festhalten konnte in solchen Momenten an Alex und seinen Atem spürte, beruhigte mich.
In dieser Zeit kümmerte sich wieder meine Mutter um mich. Es tat ihr leid, daß ich versuchte mich umzubringen. Schließlich liebe sie mich, sagte sie. Und es war ihr auch unangenehm, weil ich schließlich ihre Tochter war, die nicht einsehen wollte, daß ich, wie alle anderen auch, im sozialistischen Vaterland eine enorme Chance hätte, wenn ich nur wollte...
Selbstmordversuche waren nicht vorgesehen in der Ideologie des sozialistischen Glücksprogramms und daher moralisch nicht zu rechtfertigen. Schließlich gehörte dem Sozialismus die Zukunft und mir daher auch. Daß ich nicht einsah, welch ein Glück es für mich sei, an der besseren Zukunft der Menschheit teilnehmen zu können, sei allein meine Schuld. Ich sei verstockt, so meine Mutter. Ich wolle ihr wehtun, das sei der tiefere Grund für meine Trotzreaktionen. Als ich ihr klarzumachen versuchte, daß mir mein sozialistisches Leben hier auf die Nerven ginge, daß mich Routinearbeit fertigmache, daß ich an Stumpfsinn zugrunde ginge, versprach sie mir, sich um eine Arbeit für mich zu kümmern, in der ich Erfüllung fände, wie sie sagte. Und sie kümmerte sich auch tatsächlich. Ich wurde als Kulturfunktionärin in einem großen Krankenhauskomplex eingestellt.
Meine Mutter hatte das über die SED-Kreisleitung des Stadtbezirks eingefädelt. Sie selbst galt als Garant meiner politischen Zuverlässigkeit und sprach von dem großen Vertrauen, das sie für diese Stelle in mich gesetzt habe und von einem Risiko, das sie da eingegangen war. Ich sollte sie daher nicht enttäuschen. Natürlich begriff ich erst viel später, daß hier ein familiäres Vererbungsprinzip zur Anwendung gekommen war: Die politische Zuverlässigkeit meiner Mutter wurde auf mich übertragen, ohne daß meine wirkliche Eignung in Betracht gezogen worden war.
Die einzige Bedingung, die ich bei dieser Stellenvermittlung zu erfüllen hatte, galt einer Formsache, nämlich, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund beizutreten. Ich besprach den Eintritt mit Alex. Er fand nichts weiter dabei, in den FDGB einzutreten. Er sei selbst Mitglied dort, schon wegen des Segelclubs. Außerdem bekomme man billig Ferienreisen über die Gewerkschaft. In dem Eintritt sähe er keine Hürde, meinte er. Ich vergäbe mir nichts dabei. Ich trat also dem freien Bund bei und war plötzlich Kulturfunktionär in einem großen Krankenhaus. Für Ärzte und Schwestern sollte ich sozialistische Kultur organisieren. Was wußte ich davon. Ich griff zurück auf das, was ich kannte. Ich organisierte als erstes ein Konzert des Ärzteorchesters im Krankenhaus am Vorabend zum 1. Mai: Händel, Bartok, Brahms. Mit den Ärzten kam ich gut aus, die Fragen, die wir hatten, waren vornehmlich musikalischer Art. Neben Konzerten organisierte ich Tanzveranstaltungen. Lesungen standen auch auf dem Programm. Sie wurden mit der Gewerkschaftsbibliothek gemeinsam vorbereitet.
Die Programmanschläge der Ortskirche zu wöchentlichen Orgelvespern brachten mich auf die Idee, mit dem Pfarrer zu sprechen, ob wir nicht eine Reihe barocker Orgelkonzerte veranstalten könnten. Er war sehr angetan von der Idee. Ich hatte keine Ahnung, daß ich mit der Kirche nicht gemeinsame Sache machen durfte. Das erste Orgelkonzert fand an einem Freitag statt. Es wurden Bach und Buxtehude gespielt. Die Kirche war überfüllt. Als zwei Tage später der Organist krank war und nicht zum Gottesdienst spielen konnte, klingelte der Pfarrer in aller Frühe bei Alex und mir. Er fragte, ob ich nicht ausnahmsweise die Orgel spielen würde. Ich hatte ihm davon erzählt, daß ich in der Hochschule Orgel als Zweitfach hatte. Verschlafen wie ich war, konnte ich nur Ja-sagen. Er wartete, bis ich mich angezogen hatte, dann fuhren wir in seinem Trabant zur Kirche. Daran, daß ich als erstes den von Bach für die Orgel bearbeiteten Choral, “Wachet auf, ruft uns die Stimme” spielte, erinnere ich mich genau, auch weil ich selbst noch mit der Morgenmüdigkeit zu kämpfen hatte.
Читать дальше