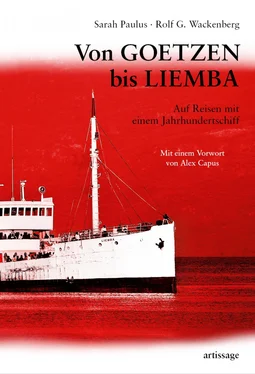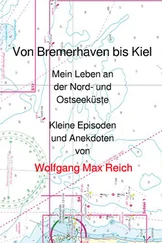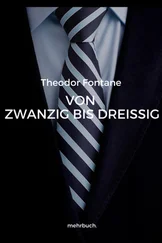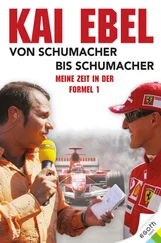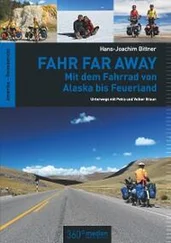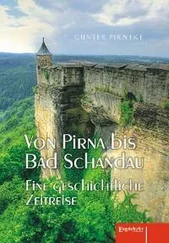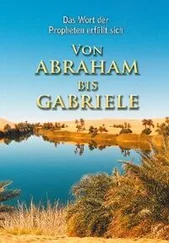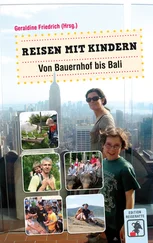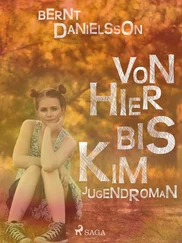Wir machen Halt im Hafen von Kasanga, am Fuße eines kleinen Hügels, dem Adadoberg, an einer Landzunge unweit des Dorfes, das sich weitläufig entlang einer malerischen Küste erstreckt. Blickfang ist eine breite Piste, die zu vereinzelten Steinhäusern und Holzhütten hinaufführt und dem kompletten An- und Abreiseverkehr dient. Warentransporte erfolgen ausschließlich über diesen Weg. Unseren Liegeplatz einen Hafen zu nennen, fällt schwer. Ja, es gibt eine Art Kai, und ja, etwa hundert Meter vom Schiff entfernt befinden sich sogar echte Lagerhallen. Und es trifft ebenfalls zu, dass tonnenweise Säcke auf ihren Weitertransport warten. Dennoch ist der vermeintliche Hafen nicht mehr als ein sperriger Betonklotz, der aussieht, als sei er versehentlich am Ufer des Tanganjikasees abgekippt und danach vergessen worden. Lastkräne und Container, die untrüglichen Insignien industrialisierter Nationen, sucht man vergebens.
Eine Schar junger Männer, zum Großteil mit gelben Arbeitsanzügen bekleidet, trifft ein und beginnt mit der Tagesaufgabe. Geschäftig schleppen sie die Fracht Sack für Sack in Reichweite des Schiffskrans. Einen Meter von der Liemba entfernt sind auf dem Boden grobmaschige Netze ausgebreitet. Die gelben Arbeiter werfen im Sekundentakt ihre Last darauf. Immer zwanzig Säcke, dann werden die Netzenden an einen eisernen Haken gehängt. Der Schiffskran surrt. Die Seile spannen sich, das schwere Bündel schwebt in Richtung Frachtdeck, um dort von anderen Männern entladen zu werden. Während unten im Halbdunkel des Frachtraums, tief im Rachen des Schiffs, die Säcke ordnungsgemäß verstaut werden, ist an Land schon das nächste Netz bereit zur Verladung.
Drum herum lungert jede Menge Volk, dicke Frauen und drahtige Männer. Einige beaufsichtigen ihre Waren oder beschriften Säcke mit Namen und Bestimmungsorten. Andere versuchen ein Nickerchen auf dem Frachtgut oder stehen in Gruppen zwischen den übermannshohen Sackreihen zusammen. Wieder andere reden auf Mande Mangabi Mwambila ein. Der Erste Offizier der Liemba beaufsichtigt den Verladeprozess. »Überwiegend Trockenfisch. Dazu Mais und Zement. Vier bis fünf Stunden wird die Verladung ganz sicher dauern«, schätzt er, wirft einen prüfenden Blick auf seine gelben Jungs und nickt zufrieden. Ununterbrochen versinkt Fracht im Bauch des Schiffs.
Am Rande des Geschehens tummeln sich übermütige Kinder. Den kleinen Quälgeistern wird der Spielplatz mit Zuschauertribüne nicht oft geboten. Laut johlend jagen sie über die Hafenanlage und hangeln an Tauen, die die Liemba mit dem Land verbinden. Anfangs folgen sie noch schüchtern den Warnungen der Erwachsenen. Nicht unter den Lastkran! Wehe, ihr stört das Verladen! Nicht auf das Schiff! Doch nach und nach gibt es kein Halten mehr. Die Mutigen entern allen Ermahnungen zum Trotz das Schiff, rennen kreischend über die Decks und stürzen sich kopfüber in den See. Unablässig wird um Aufmerksamkeit gerangelt. Hilfsweise auch ohne Badehose.
Ich entdecke Rolf, der auf dem Hafenvorplatz steht und mich zu sich winkt. Gemeinsam stiefeln wir den Hang hinauf, um ein Erbstück deutscher Kolonialträume zu besichtigen. Am Ende der Landzunge kämpfen die Ruinen der ehemaligen Militärstation und des Bezirksamtes Bismarckburg auf erhabener Position gegen Verfall, Bäume und Gestrüpp. Die 1888 von Ludwig Wolf gegründete Forschungsstation wurde später zum Sitz der Verwaltung des gleichnamigen Militärbezirks ausgebaut, dem zweitgrößten in Deutsch-Ostafrika. Hier residierten Beamte und Mitglieder der deutschen Schutztruppe. Im Ersten Weltkrieg galt sie aufgrund ihrer strategischen Lage als einer der wichtigen Stützpunkte der Westtruppen unter Generalmajor Kurt Wahle. Dieser hatte 1910 den Armeedienst quittiert. Als er im Rahmen einer privaten Reise zu Kriegsbeginn in Deutsch-Ostafrika eintraf, unterstellte er sich freiwillig einem Rangniederen, dem Kommandeur der Schutztruppe Oberstleutnant Paul von Lettow-Vorbeck, von dem ich noch berichten werde.
Die Befestigung soll aus damaliger Sicht riesig gewesen sein. Der vorgelagerte Wissmannhafen konnte von kleinen Dampfern wie auch der Liemba angefahren werden. Im Juni 1915 war Bismarckburg das Ziel ihrer ersten großen Fahrt. Damals hieß sie noch Goetzen, doch auch dazu später mehr.
Heute ist von der einstigen Boma nicht mehr viel zu erkennen. Auf dem Hang angekommen, stiefeln wir in flirrender Hitze über einen trostlosen Platz direkt auf die Burgruinen zu. Rechts von uns leblose Häuser, die perfekte Kulisse für Billy the Kid. Davor ein Lkw-Gerippe, das Rolfs Aufmerksamkeit magisch anzieht. MAN. Dahinter verrotten zwei Container in hohem Gras.
»Restricted Area«, murmelt einer, der in Schlabberhose und Flip-Flops herbeischlurft und sich als »Private« vorstellt. Was? »Army«, erklärt ein Zweiter, dessen unrasierter Habitus ebenso wenig auf Militär schließen lässt. Hinter ihnen, im Schatten großer Bäume an die Mauerreste gelehnt, sind Zelte zu erkennen. Wohl die Unterkünfte dieser verlotterten Jungs. Der Haupteingang des Stützpunkts liegt zehn Meter vor uns. Dahinter erahnen wir weitere Behausungen aus Zelttuch. Eine dürre Antenne stakt über allem in den Himmel. Was, wenn wir einfach weiterlaufen? Gibt es ein Minenfeld? Haben uns bereits Scharfschützen ins Visier genommen? Wir geben eine Weile unser Bestes. Reden, scherzen, gurren. Kein Durchkommen.
Dann eben kein Sightseeing. Stattdessen ein kühles Bad auf der anderen Seite der Landzunge. Hier öffnet sich ein echtes Idyll. So als wolle er ein Weltmeer sein, schwappt der Tanganjikasee ansehnliche Wellen ans Ufer, dunkelblau, mit weißen Schaumkronen bis zum Horizont. Wir sind allein. Raus aus den Klamotten und rein in den See. Die Wellen rauschen, waschen den Staub der vergangenen Tage von der Seele. Beim Abtrocknen ist der Strand noch immer menschenleer. Seltsam, normalerweise bleibt ein Reisender in dieser Region keine Sekunde allein. Oft ist es schwer, sich unbeobachtet im öffentlichen Raum zu bewegen. Die Nachricht von der Ankunft eines Fremden verbreitet sich meist in Windeseile, Neugier treibt unweigerlich Jung und Alt herbei. Erst ein verwittertes Schild, das wir auf dem Rückweg entdecken, gibt eine schlüssige Antwort. »Restricted Area!« Wir haben im militärischen Sperrbezirk gebadet.
Das schlechte Gewissen hält sich in Grenzen, wir haben Durst. Rolf will eh nicht sofort zurück zum Schiff, wir schauen uns um. Oberhalb des Hafengeländes entdecken wir windschiefe Hütten, bei denen sich einiges Volk zusammengefunden hat, um die Ankunft der Liemba gebührend zu betrinken.
»No cold«, informiert die geschäftige Frau hinter einem Holzverschlag und präsentiert ihr Angebot. Kein Kühlschrank und warme Getränke, die auf wackligen Holzbrettern an den Wänden aufgereiht sind. Rolf interessiert sich für die Softgetränke. »No Cola.« Dann halt Bier, warmes Bier. Bekanntlich ist Durst schlimmer als Heimweh. Wir ordern zwei Wärmflaschen Kilimandscharo Premium Lager und warten vor der Bretterbude. Die Ladenbesitzerin zählt das Geld und verlangt »Deposit«. Pfand? Schon in Mpulungu hatten wir leere Flaschen zurückgeben müssen, die Verkäufer waren ganz wild darauf. Ökologischer Fortschritt in Afrika? Ökologie statt Ökonomie? Keine Wechselstuben, dafür ein funktionierender Sekundärrohstoffkreislauf im Buschland. Kein Strom, aber Mehrweg. Ade du schöner Schlendrian, ade geliebte afrikanische Freiheit.
Wir hinterlegen den geforderten Betrag und öffnen die Flaschen. Sofort schießt warmer Schaum heraus. Als sich die Situation beruhigt hat, ist Rolfs Flasche nur noch halb voll. Wir hocken uns in den Schatten und nuckeln verdrossen am Hopfen, die Hände vom Bier verklebt. Missmutig machen wir es den Einheimischen nach. Trinken und gucken. Kein Lüftchen weht. Der See breitet sich vor uns aus, auf dieser Seite der Landzunge ohne jede Welle, platt wie eine Flunder. Auf die erste folgt eine zweite Flasche. Der Bauch gluckert. Die trockene Kehle verlangt Nachschub. Trinken und gucken. Auf das Treiben um die Liemba unten im Hafen. Auf Arbeiter und Säcke. Mit jedem Schluck mehr Säcke, wie es scheint. Noch drei Stunden bis zur Abfahrt. Wohin mit all der Zeit? Gegenüber der Bucht ragt ein Kirchturm über das tropische Grün. Dort liegt die Antwort. Im Dorf Kasanga, etwa einen Kilometer vom Hafen entfernt, zwischen Palmenhainen, Feldern und einem munter plätschernden Flüsschen.
Читать дальше