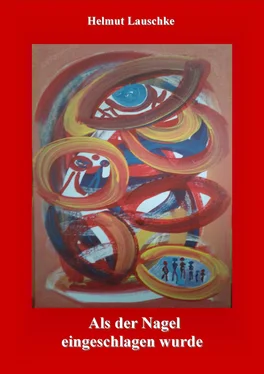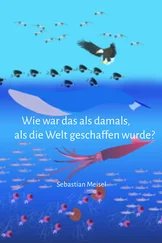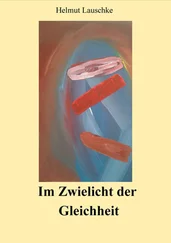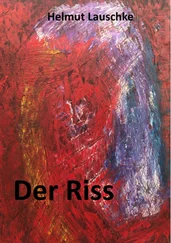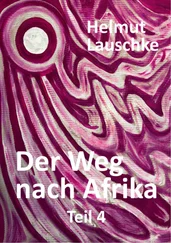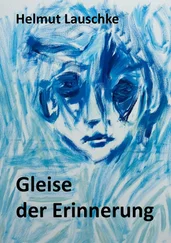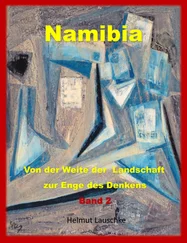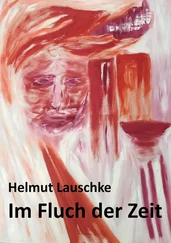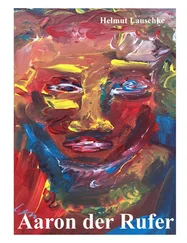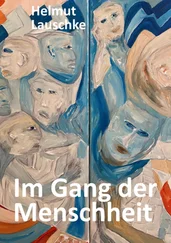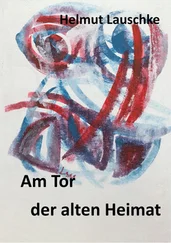Sie hatten die Tassen geleert, als Eckhard Hieronymus auf seine Taschenuhr schaute, die halbelf zeigte. Er erhob sich und drückte die Hoffnung aus, dass er diesmal Arbeit finden werde. Anna Friederike brachte den Vater zur Torausfahrt. Dabei passierten sie den Wachsoldaten, der auf dem oberen Treppenabsatz saß und auf einer kleinen Mundharmonika eine russische Volksweise spielte, die zu einem Wolgalied gehörte, in dem die Mutter besungen wird, die ihren Sohn hergibt, den sie getragen und gestillt, mit der größten Liebe aufgezogen und durch vieles Leid gebracht hatte, weil er in einen anderen Winkel der Welt zieht, um dort zu arbeiten und mit seiner Geliebten zu leben. “Vater, sei gegen eins hier. Ich koche uns ein kleines Mittagessen”, sagte Anna Friederike. Sie umarmten sich. Der Vater küsste die Tochter auf die Stirn, die es sich gern gefallen ließ. Dann machte er sich auf den Weg zum Superintendenten, dessen Haus schräg gegenüber am Albertplatz stand.
Eckhard Hieronymus Dorfbrunner auf der Suche nach Arbeit
Er klingelte, doch wie schon bei seinem ersten Besuch regte sich hinter der Tür nichts. Er klingelte ein zweites, dann ein drittes Mal. Nun öffnete die Frau die Tür auf einen Spalt, die schon damals die Tür auf einen Spalt geöffnet hatte und sich beim Ganzaufmachen der Tür als die Frau des Superintendenten zu erkennen gab. Die Frau ließ es dieses Mal beim Türspalt bewenden, durch den Eckhard Hieronymus das Grauwerden ihres Kopfhaars nicht entging. “Kann ich ihnen helfen”, sagte sie wie damals mit der Routine des schnellen Abweisenwollens durch den Türspalt. “Ich möchte ihren Mann sprechen”, sagte Eckhard Hieronymus, nachdem er sich mit vollem Namen vorgestellt hatte. “Der Superintendent liegt mit einer Grippe im Bett und ist nicht zu sprechen”, sagte die Frau, ohne die Verriegelungskette zu lösen und die Tür weiter zu öffnen. “Dann richten Sie ihm bitte meine besten Wünsche zur baldigen Genesung aus. Ich wäre dankbar, wenn mich ihr Mann anrufen würde, sobald er wieder auf den Beinen ist.” “Ich werde es meinem Mann ausrichten. Hat er ihre Telefonnummer?” “Ja, die Telefonnummer hat er.”
Die Frau hatte die Tür geschlossen, ohne “auf Wiedersehen” zu sagen. So war es ein kurzes Spaltgespräch, wobei die gute Kinderstube noch kürzer ausfiel als beim ersten Mal und der Grundstock der Höflichkeit wie vom Axthieb gespalten beziehungsweise weggeschlagen war. Enttäuscht über das Maß der Ungebührlichkeit drehte Eckhard Hieronymus dieser Tür den Rücken zu und machte sich auf den Weg zum ehemaligen Stein’schen Gymnasium, das im Zeitalter des roten Sternes mit den vielen Großplakaten der vier großen kommunistischen Wegweiser ( links die beiden Erzväter der kommunistischen Internationale mit den wallenden Rauschebärten, weiter rechts der glatzköpfige Wladimir Iljitsch mit dem kurzen Kinnbart und rechts außen der Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili mit Schnäuzer ) in Stein-Oberschule umbenannt wurde. Die Umbenennung war zeitorientiert und ging schnell vor sich, um nicht weniger schnell die Überreste des “reaktionär” verstandenen Humanismus mit all seinen griechischen Begrifflichkeiten der Athener Aristokratie aus der Schule “mit Strunk und Stiel” heraus zu fegen, indem das griechische Wort für Schule entfernt, dadurch am wirksamsten entmythologisiert und durch das deutsche Wort aus der Sprache der Arbeit ersetzt wurde, das verständlicher im Denken und leichter im Aussprechen für die neue obere Klasse war. Das Wort ‘Schule’ liegt der Hand und dem handbezogenen Denken näher als das Gymnasium. Das eine ist eben handfester und zeitbezogener als das andere.
Eckhard Hieronymus stand vor dem Schulportal, über dem ein weißes Tuch aufgespannt war, das fast die ganze Gebäudefront einnahm und bis zu den Fenstern im ersten Stockwerk reichte. Darauf stand mit fetten schwarzen Lettern: “Wir danken dem Genossen Stalin, dem großen weisen Führer.” Eckhard Hieronymus stieg die Stufen der breiten Treppe zum Portal, unterquerte den aufgespannten ‘Weisheits’-Spruch, ging das ‘L’ im linken Flur bis zum Ende und klopfte an die Vorzimmertür. Da sich nichts tat und hinter der Tür nichts zu hören war, klopfte er noch einmal, diesmal kräftiger. Nun schwirrte ein leises “Herein!” gegen die Innenseite der Sekretariatstür, dessen Quelle weit weg zu sein schien, in einen Nebenraum etwa, der auch der Hauptraum, die Schaltzentrale der Schule sein konnte, wo der Direktor hinter dem großen Schreibtisch sitzt, vorausdenkt und vorausschreibt, der die Macht im Hause hat, den ihm unterstellten Lehrkörper aus antifaschistischen Lehrkräften der neuen Generation und den wenigen konservativen, wieder eingestellten Studienräten der alten Generation nach Belieben zu bewegen und, wenn’s ihm dünkt, um seinen Schreibtisch tanzen zu lassen. Darüber hinaus ist er der unangefochtene Herrscher über Zucht und Ordnung der Schüler im Allgemeinen und über ihre Pünktlichkeit im Besonderen. Die Tür öffnete ein hochgewachsener Endvierziger im grauen Anzug mit offenem Kragen, fliehender Stirn, braunen Augen, großer Nase, großen Ohren, Glatze und ergrautem Kinnbart à la Iljitsch.
“Feigel, kommen Sie doch rein!” Sie gingen durchs Sekretariat mit der fehlenden Sekretärin, dann durch die Tür zur ‘Schaltzentrale’. “Nehmen Sie Platz!”, sagte der Direktor, als er sich schon auf seinen Stuhl mit der hohen Rückenlehne und den beiden Armlehnen hinter den Schreibtisch gesetzt hatte. “Kann ich etwas für Sie tun?”, fragte der Direktor. Eckhard Hieronymus fiel bei der Fragestellung das Abzeichen der wehenden roten Fahne am rechten Jackenaufschlag auf, wie es die neuen und alten Kommunisten mit dem Stolz der größeren Zukunftserwartung trugen. ( Das Tragen des Abzeichens räumte besonders bei den Jungkommunisten den Zweifel nicht aus, ob sie es aus Überzeugung oder aus opportunistischem Mitläufertum heraus taten .) Eckhard Hieronymus kam mit seinen Gedanken auf die an ihn gestellte Frage zurück und sagte auf einfache, dafür überzeugende Weise das, was er zu sagen sich vorgenommen hatte: “Herr Feigel, meine Stärke sind die Sprach- und Literaturkenntnisse in Deutsch und Latein sowie das solide Geschichtswissen; meine Schwäche ist, dass ich ohne Arbeit bin.” “Wie war doch ihr Name?”, fragte mit einem Lächeln der Direktor, als hätte er das Anliegen verstanden. Eckhard Hieronymus nannte seinen Namen das zweite Mal. “Wenn Sie ein eingetragenes KP-Mitglied wären, sofort. Da Sie es offensichtlich nicht sind, denn ich sehe Sie heute das erste Mal, sieht die Prognose düster aus. Verstehen Sie mich richtig: Sie tragen den Namen eines Heiligen, doch für uns Kommunisten ist die Zeit der Heiligen vorbei. Bei Leuten wie ihnen versteckt sich reaktionäres Gedankengut auch dann noch, wenn sie es nicht mehr wollen und sich bemühen, das alte Zeug über Bord zu werfen, sich der Zeit und ihrer herrschenden Klasse anzupassen, um ihre Füße wieder auf den Boden, damit eine Arbeit und mit der Arbeit wieder einen geachteten Platz nun in der neuen Gesellschaft zu bekommen.
Das darf ich ihnen aus Erfahrung sagen: überkommenes, reaktionäres Denken lässt sich weder rauswaschen noch rausbürsten noch wie beim Hemdswechsel in das neue Denken umwechseln. Ich meine das sozialistische Denken nach dem Vorbild unseres großen Führers Josef Wassarionowitsch Stalin.” Bei Eckhard Hieronymus schwollen die Adern: “Verstehen Sie mich bitte richtig”, erwiderte er, “Sie gehen an der wissenschaftlich dialektischen Denkweise vorbei, wenn Sie von meinem Namen auf mein Wissen, meine Intention und mein Denken schließen. Meine Intention ist, Deutsch und Latein, und wenn möglich, Geschichte zu unterrichten.” “Geschichte auf keinen Fall!”, sagte Herr Feigel, “oder haben Sie die Bücher der führenden sowjetischen Historiker studiert?” “Nein, das habe ich nicht.” “Sehen Sie, da würden Sie wieder mit den alten, kapitalistischen Kamellen kommen, die doch nicht stimmen, wie die neueste Geschichtsforschung herausgefunden hat.” Eckhard Hieronymus schwieg, weil er eine Arbeit suchte und nicht die Auslösung eines Eklats. Der Direktor fuhr fort: “An ihren Sprachkenntnissen will ich weniger zweifeln, da politisch an der Rechtschreibung nichts auszusetzen, wenn auch beim Interpunktieren von Haupt- und Nebensätzen, vor allem beim Setzen der Kommas politisch doch genauer hinzusehen ist, wenn der Schreiber seine Absicht und die Gedanken aus der reaktionären, konterrevolutionären Bourgeoisie hervorkramt. Da sind dann schon aus der Sicht der neuen Gesellschaft Anmerkungen und Korrekturen nötig, damit das Postulat der nun herrschenden Klasse der Arbeiter und Bauern nicht verfälscht wird. Auf die Problematik mit der Interpunktion und dem Rummanipulieren mit den Kommas hat schon der Altgenosse Wladimir Iljitsch Lenin kritisch hingewiesen.
Читать дальше