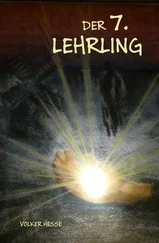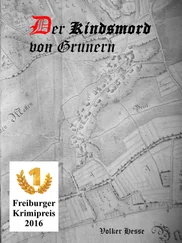„Sind Sie gegen Tetanus geimpft, Herr Vallier?“ fragte ein Sanitäter. Vallier hatte keine Ahnung. „Nicht dass ich wüsste“ antwortete er. „Beim letzten Mal hab’ ich’s aber auch überlebt.“
Zumindest sein Sarkasmus hatte sich wieder eingestellt.
„Dann müssen Sie sich sofort im Krankenhaus impfen lassen“ meinte der andere Sanitäter. „So etwas kann böse enden.“
„Na, Sie sind gut“ erwiderte Vallier. „In einer Viertelstunde beginnt die Premiere. Ich kann jetzt nicht weg und die Leute stundenlang warten lassen.“
Die Sanitäter empfahlen Vallier, die Impfung nach der Aufführung nachzuholen und legten ihm einen Zettel vor, auf dem zu lesen war, dass er freiwillig auf die weitere Behandlung verzichtete, er über die Folgen seiner Verweigerung aufgeklärt worden und er demnach für etwaige Folgeschäden selber verantwortlich war. Vallier unterschrieb das Papier und die beiden Sanitäter verließen seine Garderobe.
Vallier fühlte sich schrecklich elend. Er kramte in der Außentasche seines schwarzen Aktenkoffers, in der er seit jeher allerlei nützliche Dinge aufbewahrte: Bleistifte, Spitzer, Büroklammern, Manschettenknöpfe, Schnürsenkel, Aspirin, Früchteriegel, Ersatzlesebrillen, Pfefferminzbonbons. Nach einigem Suchen fand er seine Kreislauftropfen, die er immer wieder brauchte, denn er war sehr wetterfühlig und besonders die süddeutsch-österreichische Föhnwetterlage vertrug er denkbar schlecht. Er erinnerte sich an eine Begebenheit von vor ein paar Jahren, als er bei einem Gastspiel in Bayern mitten in der Orchesterprobe sein Dirigentenpult hatte verlassen müssen, weil er befürchtete, jeden Moment ohnmächtig zu werden.
Jetzt zählte er dreißig Tropfen in ein Wasserglas ab und trank.
Vallier blickte auf die Uhr. Noch zehn Minuten! Schwerfällig begann er, seine Arbeitskleidung - einen schwarzen Frack, den er hasste – aus der Verhüllung zu schälen und sich umzuziehen.
Es klopfte an der Tür und der Intendant des Festspielhauses trat ein. Er war mittlerweile von Valliers Unfall unterrichtet worden.
„Wie geht’s Ihnen, Herr Vallier?“ fragte er. „Sie sehen nicht gut aus. Werden Sie dirigieren können?“
„Na, es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Oder haben Sie eine andere Idee?“ entgegnete Vallier ein wenig patzig.
„Nun, wir können den Beginn der Vorstellung noch um etwa eine Viertelstunde verzögern. Würde Ihnen das etwas nützen?“
„Unbedingt“ meinte Vallier, „ich bin noch ein wenig zittrig auf den Beinen.“
„Gut, dann werde ich das so veranlassen. Gute Besserung und toi-toi-toi.“ Damit verließ der Intendant Valliers Garderobe.
Vallier war weiterhin ziemlich übel. Zudem brach ihm der Schweiß aus allen Poren, denn der klobige Frack war denkbar unbequem. Es war ein strahlender, sehr warmer Frühsommertag gewesen und auch jetzt – abends – war die Temperatur noch ungewöhnlich hoch. Er schlüpfte in seine schwarzen Lackschuhe und begann, die Schnürsenkel zuzubinden, als ihm plötzlich wieder schwindlig wurde. Verzweiflung stieg in ihm hoch. Er hatte keine Ahnung, wie er die Vorstellung überstehen sollte. Unmöglich konnte er absagen und die Leute nach Hause schicken aber genauso unmöglich würde er in dieser Verfassung dirigieren können.
Mit zittrigen Händen versuchte er, die weiße Schleife um den steifen Hemdkragen zu legen. Dabei blickte er in den Spiegel und erschrak vor seinem eigenen Antlitz. Der Intendant hatte recht: er sah grauenvoll aus. Seine Gesichtsfarbe war aschfahl und ging bereits ins Grünliche über, eine dünne, eingetrocknete Blutbahn zog sich vom Mundwinkel bis zur Kinnspitze. Unter den Augen furchten sich zwei tiefe Tränensäcke.
Er öffnete die Garderobentür und rief nach einer der Garderobieren. Nach wenigen Augenblicken erschien eine der Damen.
„Herr Vallier, was haben Sie denn gemacht?“ rief sie erschrocken und begann sofort, sein Gesicht zu säubern und ihm seine weiße Schleife um den Hals zu binden, was ihm bei seinem Selbstversuch vorhin nicht geglückt war. Dann fönte sie seine schweißnassen Haare und brachte sie wieder in Facon.
Die Lautsprecherstimme der Inspizientin forderte das Ensemble nunmehr auf, die Plätze einzunehmen: „Die Damen und Herren des Orchesters bitte in den Orchestergraben, die Damen und Herren des Opernchores und alle Solisten auf die Bühne. Herr Vallier bitte.“
In dem Moment, als er seinen Namen hörte und ihm die Unausweichlichkeit seiner Situation heftig ins Bewusstsein kam, breitete sich in Vallier ein Gefühl der Panik aus. Unmöglich würde er das Kommende überstehen. Ihm war speiübel, schwindelig, er fürchtete eine erneute Ohnmacht und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Dabei hieß es doch immer, jedermann sei ersetzbar! Genau das wünschte er sich jetzt. Sich einfach hinlegen zu dürfen und sich auszuruhen!
Die Garderobiere hielt ihm ein Glas Wasser hin und drängte ihn, einen Riegel Schokolade zu essen. „Gegen Unterzuckerung“ meinte sie. Vallier aß widerwillig und machte sich, auf die Garderobiere gestützt, auf den Weg zur Bühne. Neugierige und mitleidvolle Blicke begleiteten ihn, denn natürlich hatte sich sein Zustand mittlerweile herumgesprochen.
Der Intendant erwartete ihn auf der Bühne.
„Wird’s denn gehen?“ fragte er sorgenvoll.
„Ja, ich wüsste nicht, was ich jetzt lieber täte“ knurrte Vallier und machte eine abwehrend-beruhigende Handbewegung. Er versuchte, sich zu konzentrieren. Schließlich gab ihm die Inspizientin das Zeichen, dass es losgehen könne.
„Toi-toi-toi“ flüsterten ihm dutzende von Stimmen zu, als er sich auf den Weg zum Orchesterraum machte, nach wie vor begleitet und gestützt von der braven Garderobiere, der er, so nahm sich Vallier heftig vor, später unbedingt ein Dankesgeschenk machen musste.
Er blieb vor der Eingangstür zum Orchestergraben stehen. Dort wurde er von einem der Orchesterwarte erwartet, der durch den Türspalt in den Saal spähte. Sobald das Saallicht erloschen und erwartungsvolle Stille eingetreten war, öffnete er die Tür. Vallier gab sich einen Ruck und betrat den Orchesterraum. Applaus brandete auf. Er erklomm sein Podium, verneigte sich in Richtung Publikum, begrüßte den sorgenvoll dreinblickenden Konzertmeister mit Handschlag und ließ den Blick über sein Orchester gleiten. Für einen Augenblick vergaß er seine Übelkeit. Alle waren da. Er genoss jedes Mal diesen Anblick. Etwa 70 schwarz gekleidete Menschen – die Damen in langen Abendkleidern, die Herren in Fräcken wie er selber – blickten ihn tatendurstig an, willens, ihrem Beruf nachzugehen. So liebte er es. Die Musiker mussten – bildlich gesprochen – auf den Vorderkanten ihrer Sessel sitzen, bereit, das Beste zu geben. Nichts war im Moment wichtiger, als genau das, was jetzt geschehen würde.
Vallier hob den Taktstock und gab den Einsatz zur kurzen Ouvertüre. Während er dirigierte fühlte er, wie es ihm langsam besser ging. Sein Kreislauf begann wieder zu funktionieren. Die Ablenkung durch die Musik, die Konzentration auf und die Anstrengung durch das Dirigieren schienen ihm gut zu tun. Nach etwa fünfundzwanzig Minuten war er wieder fast der Alte: hochkonzentriert, schwungvoll, federnd und ganz bei der Sache. Einsätze gebend und mit der linken Hand die Lautstärke formend versuchte er, den großen musikalischen Bogen herzustellen, die Musik dadurch verstehbar zu machen, und mit den Sängern und Instrumentalsolisten zu atmen und dem Chor den Text vorzusprechen.
Auf der Bühne indes wurden die tragischen Liebesgeschichten Hoffmanns erzählt: seine Liebe zur unerreichbaren, pomphaften Opernsängerin Stella, zur anmutig-puppenhaften Olympia, zur schwindsüchtigen, fiebernden. Sängerin Antonia und zur Liebe heuchelnden Edelhure Giulietta. Der erste Teil des Abends ging mit dem Tod der durch Hoffmann und ihre tote Mutter zum Gesang verführten Antonia zu Ende. Heftiger Applaus setzte ein und während die Saallichter angingen, verließ Vallier sein Dirigentenpodium und begab sich in seine Garderobe.
Читать дальше