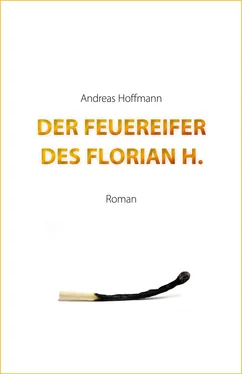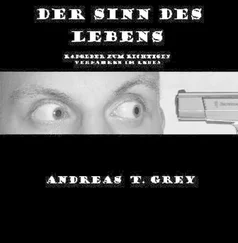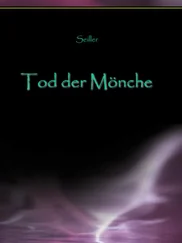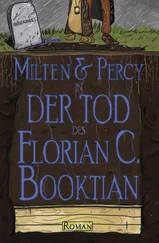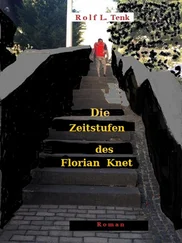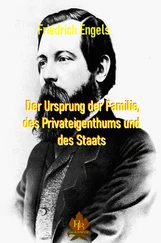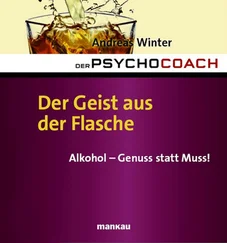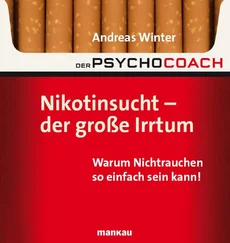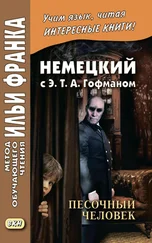Auch bei Heiner? Wie schon den ganzen Tag, geht er ihm selbst bei sechzig Sachen im Berufsverkehr nicht aus dem Kopf. An eine glückliche Erklärung für sein Fehlen glaubt er nicht mehr. Optimismus, ja, Zweckoptimismus, mit jeder Stunde ausbleibender Nachrichten schwächer werdend. Er ahnt inzwischen Schlimmstes.
Die Bülow-, Yorck- und Gneisenaustraße hinter sich, hat Leos Wagen den Südstern erreicht. Die Ampel springt auf gelb. Sie bremst. Einer in Shorts und T-Shirt stellt sich vor ihr Auto und gestikuliert mit einem Scheibenreiniger. Auffordernd nickend dreht sich Leo zu ihrer Handtasche auf dem Rücksitz.
Florian sieht nur Heiner vor sich – vor der großen, grauen, kaiserlichen Garnisonkirche auf der Mitte des Platzes. Ein Haus für des Kaisers Krieger. Kurz nach Ostern erst haben sie sie besichtigt, alle Sechs. Die beiden Kinder haben sich lustig gemacht über die grinsenden durstigen Ungeheuer, die draußen lästerlich mit ihren langen, spitzigen Mäulern und Schnäbeln aus den Wandecken gaffen und schon längst kein Regenwasser mehr speien. Und drinnen diskutierten die Erwachsenen die Sprüche an den Wänden: die Strophe von Gott, der ein feste Burg ist, ein gute Wehr und Waffen, hammerhart wie Luthers Thesenanschläge an der Wittenberger Schlosskirche. Wozu überhaupt? Florian dozierte damals von Hottentotten, Boxern und Hereros, denen die Gottesdienstteilnehmer dieser Kirche (Helm ab zum Gebet!) zu Leibe rückten und die Wüste heiß machten, wenn sie nicht strebsam waren, in Reih und Glied, so wie es sich gehört. Selbst wenn es dein eigener Bruder ist, Rekrut! Schieß auf ihn. So sprach der Kaiser, der die Kirche bauen ließ. „Gute Wehr und Waffen? Kannste heute übertünchen. Hat mal jemand ‘ne Flasche tipp-ex da?“, schlussfolgerte Heiner und Hilke lachte dazu. Sie standen um das Taufbecken herum. Merkwürdig. Und Leo antwortete lutherfest: „Nicht so eilig, mein lieber Heiner. Das Wort solltest du lassen stahn. Wird immer noch gebraucht. Hurra und Halleluja auf unseren Doktor Martin Luther und alles, was den Geschäftsinteressen frommt, sei es am Hindukusch, in Bagdad oder auf dem Balkan und gegen die Belagerer der festen Burgen an den Tagungsorten von G8, IWF und Weltbank.“
Ob Leo auch gerade an Heiner denkt?
Die Ampel springt auf grün und mit ihr springt der gestiefelte Scheibenwischer von der verschmierten Windschutzscheibe zurück neben Leos Wagentür. Sie drückt ihm eine Münze in die Hand, dann den Knopf für die Scheibenwischanlage und wischt sich schließlich deren Spritzer von der Stirn. Die nächste Ampel zeigt schon bei Ankunft grün, der Verkehr kommt in Fluss, das Gespräch nun auch. Florian wendet es nicht auf Heiner, sondern seinen Sohnemann.
„So aufgeweckt der Robert ist, am Telefon sagt er nicht viel.“
„Er hätte gar nicht erst rangehen dürfen“, meint Leo. „Ich als Entführerin wüsste jetzt, dass bei Robert und Ricarda Besuchszeit ist.“
„Hilke hat ihnen bestimmt verboten zu telefonieren, wenn sie nicht da ist.“
„Sicher, Flo.“ Leonore beschleunigt. Hasenheide, linke Fahrspur. Leo vorneweg. Freie Fahrt. Die Spitze der Tachonadel kratzt die Achtzig. „Aber stört den Robert das? Wie oft sagen wir den Kindern, wenn wir mit ihnen unterwegs sind: ‚Tut dies nicht, tut das nicht‘. Robert macht doch trotzdem, was er will. Weißt du noch, wie wir im Schlosspark nach ihm gesucht haben? Und wie wir ihn dann im Batseba-Brunnen fanden, mit nasser Unterhose, die Hand am Wasserstrahl?“
„Stimmt, aber erst als wir die vollgespritzten Fußgänger schimpfen hörten.“
„Und Ricarda fing an zu kreischen, sie wolle auch zu der nackten Frau ins Becken.“
„Oh ja, ein toller Nachmittag. Einer der seltenen Momente, wo ich froh war, dass wir selbst keine Kinder haben.“
Nach zwei Runden um Florians Mietskasernenblock findet Leo eine Parklücke. Sie schließt Verdeck und Türen, dann tauchen sie ein in den Lärm der Karl-Marx-Straße. Sie holt vom Istanbul Markt noch eine Tüte voll Gemüse, Oliven und Fladenbrot. Er geht schon vor, durch die schiefe Tür zu Haselbach/Baken, erster Stock. Auf dem Treppenabsatz plauschen Frau Öczan, die quirlige Kleine aus dem dritten Stock, und Florians Nachbarin, Oma Schudoma, Franziska mit christlichem Namen, stets adrett frisiert und – wie alt sie auch sein mochte – à la mode gekleidet, ganz Dame von Welt, einer vergangenen Welt, in der der vordere Aufgang für Dienstboten tabu war und auf den Klingelschildern noch Fritsche, Bergmann, Dr. Schellenberger stand, auf einem sogar „Carl August von Krause“.
„Guten Tag, Herr Haselbach.“
„Guten Tag“, Kopfnicken, Lächeln und schnellstens hinein in den Schutz der Wohnung. Alltägliche Treppenhaushöflichkeit und vorgetäuschte Geschäftigkeit als Verteidigung gegen die Nachbarn, die – o Hilfe – versucht sein könnten, Florian in ein Gespräch zu verwickeln.
Tür zu, Jacke auf den Bügel, Schuhe parallel mit der Spitze zur Wand, auf Socken in die Küche, hellbraunes Leitungswasser und dunkelbraunes Pulver in die Kaffeemaschine, den müden Körper ins Wohnzimmer, Beine ausgestreckt aufs Sofa, kurzum: abschalten, so gut es geht.
Eine halbe Stunde später kommt auch Leo und sortiert die guten Dinge aus der Istanbul-Markt-Tüte in der Küche ein. Durch zwei Türen erzählt sie laut von Receps Kassendifferenz im Istanbul-Markt, von Frau Schudomas erfolgreichem Enkel und Frau Öczans vergeblichem Versuch Arbeit zu finden.
Florian hört nur halb hin. Ihm schwindelt vor dem Telefon, das auf dem Schreibtisch turmhoch aufragt, umso steiler und höher je heftiger er daran denkt. Hilke anrufen! Hilke Höfner. Heiners Frau! Heiners Witwe?
Flo krampft sich der Magen. Aus Angst vor dem Gespräch, aus Angst vor der schrecklichen Möglichkeit, die ihn bedrängt. Der Optimismus, Heiner könnte sich am Apparat melden, ist verflogen.
Leo, inzwischen barfuß, in Shorts und Bluse, kommt mit zwei Tassen Kaffee, einer weiß, der andere schwarz, aus der Küche zurück und winkelt sich in den Sessel. Sie scheint gefasster zu sein als Florian.
„Soll ich mit ihr sprechen? Von Frau zu Frau?“
Ein Angebot so verlockend wie unmöglich, denkt Florian. Es wäre eine Premiere. Immer waren Florian und Heiner am Draht, mit Gruß an Leo und Gruß an Hilke und die Kinder. Leonore mit Heiner, Leonore mit Hilke: solche Ferngespräche kamen nicht vor. Florian mit Hilke übrigens auch nicht oder nur kurz, wenn ausnahmsweise sie am Hörer ist („Kannst du mir mal Heiner geben?“).
So gern er Leo das Telefon hinreichen, sie mit der befürchteten Nachricht konfrontieren würde, er schüttelt den Kopf. Er hat vormittags schon zweimal mit Hilke telefoniert. Er wird es auch jetzt tun.
Er geht zum Schreibtisch, zieht das Telefon an seinem Antennenstummel aus der Halterung, wählt Heiners Nummer und legt das Gerät ans Ohr. Nichts zu hören. Dann von weit her der Doppelton. Noch einmal. Noch einmal.
„Höfner.“ War das Hilkes Stimme? „Wer ist denn da?“ Noch vier Wörter, fragil, leise, fast ängstlich, schüchtern und einschüchternd, zerschmettert und zerschmetternd. Florians Mut klumpt sich zusammen und sinkt. Er ahnt schon jetzt die Nachricht. Dieses brüchige Timbre kennt er nicht. Nicht von Hilke. Er weiß, dieser Ton bedeutet Trauriges.
„Hier ist Florian.“ Für den Unsinn, den er dann herauslässt, hätte er sich hinterher backpfeifen können, für den Schwall von überflüssigem, dummem Zeug, das er plappert. In ungewohnter Redeseligkeit. Der zerbrochenen Stimme am anderen Ende Pausen geben, Kraft zu neuen Sprechansätzen. Müssen denn wirklich alle Nachrichten, auch die unfassbarsten, in Worte gefasst werden? Mit Subjekt, Prädikat und Objekt, mit Adjektiven, Präpositionen und adverbialer Bestimmung, messerscharf und schmerzhaft: Wer, wann, wo und wie? Unter dem quälenden Einsatz unseres aufgeklärten Denkapparats, unter der Folter unserer Sprechwerkzeuge. Warum genügen uns nicht Gesten oder Laute, leise, ganz leise, als Signale?
Читать дальше