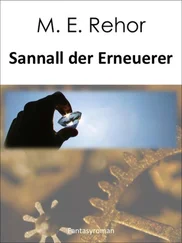„Es geht mir nicht gut.“
Das sagte Benjamin genug. Rosalinde war erst vierzehn, wog aber schon mehr als vier Zentner. Ihr Körper kam mit dem Gewicht nicht mehr zurecht. An manchen Tagen musste Mamschka draußen im Zelt auf sie verzichten. Aber es arbeiteten noch zwei nicht ganz so dicke Mädchen für Mamschka. Die genügten, um Zuschauer anzulocken, auch wenn ‚das Kolossalkind Rosalinde‘ als Star der Vorführung fehlte.
Rosalinde legte den Lappen beiseite. „Wie ist das passiert?“, wollte sie wissen.
„Grabow hatte einen Wutanfall. Was ist mit dir?“
„Ich bin wieder ohnmächtig geworden.“ Rosalinde lief trotz des kühlen Wetters der Schweiß herunter. Der ganze Wohnwagen war erfüllt von dem Schweißgestank und dem süßlichen Bouquet des billigen Parfums, mit dem sie versuchte, ihren Körpergeruch zu überdecken.
„Wenn du nicht abnimmst, wirst du sterben“, mahnte Benjamin. „Du weißt, was die Ärzte sagen.“
„Ich darf nicht abnehmen. Wenn die Leute keinen Eintritt mehr bezahlen, um mich zu sehen, setzt mich Mamschka aus. Sie hat erst gestern wieder damit gedroht. Wir sind eh fast pleite.“
„Vielleicht kannst du ein ganz normales Leben führen, wenn du dünn wirst“, munterte Benjamin sie auf. Er hatte das schon Dutzende Male gesagt und wusste, dass es unsinnig war. Rosalinde war auf Gedeih und Verderb an Mamschka gebunden, so wie er an Grabow. Aber er konnte die Hoffnungslosigkeit in Rosalindes Augen nicht verkraften, wenn von ihrem Aussehen die Rede war.
„Ich habe einmal abgenommen, als Kind, weil ich krank war“, erzählte Rosalinde die alte Geschichte wieder, die ihr selbst als Rechtfertigung für ihr Dulden diente. „Ich sah aus wie ein Monster. Die Hautfalten hingen wie Säcke an mir herunter. Jetzt finden die Leute mich wenigstens niedlich, weil ich in den Rüschenkleidern wie ein Riesenbaby wirke.“
„Noch“, sagte Benjamin und bereute es gleich wieder.
„Du brauchst nicht so zu reden! Im Gegensatz zu mir könntest du wirklich weggehen. Und sag jetzt nicht, du hättest keine Chance im Leben, weil du ein Afrikaner bist. Du bist ein Mischling. Deine Haut ist so hell, dass du nur zu behaupten brauchst, du seiest ein Italiener aus dem Süden, und jeder würde dir glauben.“ Rosalinde blickte auf Benjamin herunter, der vor ihr auf dem Boden saß.
Benjamin wechselte schnell das Thema. „Was ist mit meinem Vater?“, fragte er.
„Gestern hat Grabow im Suff Mamschka verprügelt.“
Das interessierte Benjamin nicht sonderlich. Die Schmerzen auf seinem Rücken wurden stärker und machten ihn fast verrückt. Er riss sich zusammen und sagte: „Ich habe sie vorhin gesehen. Sie hat ein blaues Auge.“
„Und jede Menge blauer Flecken. Sie war betrunken und hat die halbe Nacht auf Grabow geschimpft.“ Rosalinde keuchte ein paarmal, bevor sie weiterreden konnte. Ein triumphierendes Blitzen ihrer Augen kündigte den nächsten Satz an: „Sie sagte, es sei schlimm, wie er alles Geld versäuft und verspielt, das er von deinem Vater bekommt.“
„Der ist tot!“
„Mamschka muss es besser wissen“, widersprach Rosalinde. „Sie hat ganz früher mal mit Grabow zusammengelebt.“
Das war ein Argument. Mamschka kannte Grabow schon, als Benjamin noch gar nicht geboren war. „Wenn das stimmt, haben es mir beide immer verheimlicht. Warum sollten sie das tun?“
„Grabow, weil er das Geld deines Vaters vertrinkt, und Mamschka aus Angst vor Grabow. Wahrscheinlich erwartet dein Vater, dass Grabow dich für das Geld gut erzieht. Mit Schule und so. Stattdessen lässt Grabow dich für sich arbeiten. Du musst herausfinden, um welche Summen es geht. Bestimmt gibt es Schecks oder Quittungen.“
„Dann sind sie in Grabows Eisenkassette. Den Schlüssel trägt er Tag und Nacht an einer Kette um den Hals. Als Kind habe ich mal versucht, die Kassette zu öffnen. Er hat mich erwischt und verprügelt.“
„Jetzt bist du kein Kind mehr.“ Rosalinde griff nach einem Fächer und wedelte sich Luft zu. „Du musst deinen Vater suchen und ihm sagen, was Grabow getan hat.“
Benjamin mochte diese Idee nicht. Wenn sein Vater wirklich noch lebte, hatte er Benjamin verstoßen – wegen der Hautfarbe, warum auch sonst? Benjamin war sich nicht sicher, ob es richtig war, zu so einem Mann zu gehen. Er sah in Rosalindes Gesicht. Waren es Schweißtropfen oder Tränen, die über ihre Wangen liefen? „Vielleicht tue ich es“, sagte er.
„Schau zumindest nach, was in der Kassette ist. Versprichst du mir das?“
„Klar. Wenn sich die Gelegenheit ergibt.“
„Dafür musst du sorgen! Nicht immer warten, Benjamin“, tadelte ihn Rosalinde. Sie wäre gerne Lehrerin geworden, das merkte man manchmal. Auch wenn sie selbst nur ein paar Monate in ihrem Leben eine Schule besucht hatte, den strengen, fordernden Ton hatte sie sich gemerkt.
„Also gut: versprochen!“
„Dann sage ich dir jetzt, wie du an den Schlüssel für die Kassette herankommen kannst. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Dort neben dem Spiegel liegt ein Papiertütchen mit Pulver.“
Benjamin stand auf und holte es. Das Tütchen war eines von der Sorte, in der Apotheker Medikamente in einzelnen Portionen verkauften.
Rosalinde bestätigte seine Vermutung: „Das ist ein starkes Schlafmittel, das Mamschka manchmal nimmt. Ich habe es ihr stibitzt. Jetzt brauchst du nur noch eine Flasche Schnaps. Errätst du meine Idee?“
Benjamin lachte, auch wenn ihm nicht wohl war bei dem Plan, den Rosalinde ausgeheckt hatte. „Ich verstehe“, versicherte er. Sein Herz schlug noch schneller als vorhin bei der Flucht aus dem Zelt. Hier eröffnete sich ihm ein Weg in die Freiheit. Eine Freiheit, die nicht ungefährlich war für einen wie ihn. Wie schlecht Grabow ihn auch behandelte, Benjamin war auf dem Rummel sicher vor Nachstellungen wegen seiner dunklen Hautfarbe. Wäre es nicht fahrlässig, diese Sicherheit aufzugeben?
„Ich werde es tun“, beteuerte er noch einmal. Er war selbst überrascht über die Festigkeit in seiner Stimme.
Zufrieden ließ sich Rosalinde zurücksinken. „Dann mach dich jetzt sofort daran!“, befahl sie.
Trotz seiner Angst vor Grabow schlich sich Benjamin zurück zum Zelt. Die Petroleumlampen brannten noch. Zwischen den umgestürzten und zerschlagenen Stühlen lagen zwei Schnapsflaschen. Eine davon war nicht ausgelaufen, die nahm er mit. Schmeckte der billige Schnaps anders, wenn das Schlafpulver darin aufgelöst war? Benjamin öffnete das Papiertütchen und probierte eine winzige Menge des Pulvers. Es war sehr bitter. Blieb also nur die Möglichkeit, Grabow weiszumachen, dass der Schnaps bitter schmecken musste, weil er etwas Besonderes war.
Im Mondlicht ging Benjamin über den dunklen Rummelplatz. Hier kannte er sich aus. Als Kind war er oft nachts aus dem Wohnwagen geschlichen, um sich draußen umzusehen. Es war dann so still und friedlich, ganz anders als tagsüber und abends, wenn Besucher über den Platz strömten. Nur die Gerüche hingen noch immer in der Luft: gebratene Wurst, Hustenbonbons, Pferdeäpfel. Er wüsste sogar mit geschlossenen Augen, wo er sich gerade befand.
In einem Abfallkorb entdeckte er eine bauchige Flasche mit ausländischem Etikett. Vielleicht französisch, was bei Alkohol ja immer gut war. Er füllte den Schnaps in die bauchige Flasche um, ließ das Pulver aus dem Tütchen hinein rieseln und verkorkte die Flasche sorgfältig. Dann kehrte er ins Zelt zurück und versteckte sie.
Die restliche Nacht verbrachte er unter Grabows Wohnwagen. Das tat er immer, wenn er sich dessen Zorn zugezogen hatte. Aus dem Stall, in dem die Zugpferde standen, holte er Stroh und breitete es unter dem Wagen aus. Er legte sich mit dem Bauch darauf, weil er es auf dem Rücken nicht aushielt, und hörte über sich Grabow randalieren. Als Grabow zu Schnarchen anfing, fand auch Benjamin ein wenig Schlaf.
Читать дальше