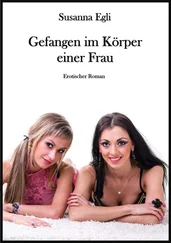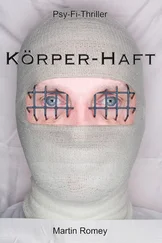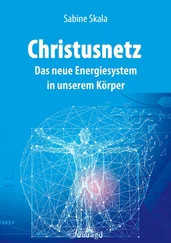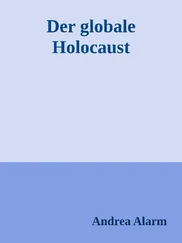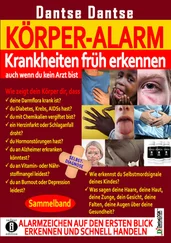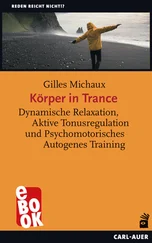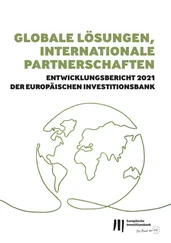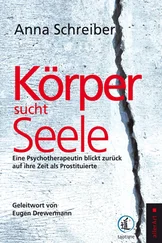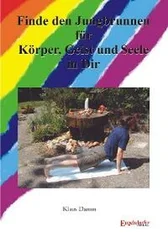Teilnehmende Beobachtung
Die wichtigste Methode innerhalb meiner Forschungsschritte in den Probenprozessen war die Teilnehmende Beobachtung. Die in der ethnographischen Forschung zentrale Methode setzt die Anwesenheit und Teilnahme der Forscherin im Forschungsfeld strategisch ein.{53}
Ich war in den Forschungssequenzen auf verschiedene Weisen mit in den Entstehungsprozess involviert – ob als Regieassistentin, Gesprächspartnerin, Ausführerin organisatorischer Tätigkeiten, Beobachterin, Teilnehmerin an Workshops zusammen mit den PerformerInnen, Platzhalterin im Krankheitsfall oder bei Lichtproben. Je nach Produktion und Rolle variierte der Grad meiner Einbindung in den konkreten Entstehungsprozess. Ich habe viele Stunden am Rand der Probebühne verbracht, minutiöse Veränderungen im Material mitbekommen, unzählige Wiederholungen des gleichen Materials gesehen und dokumentiert.
Gerade dieses konstante Anwesend-Sein ermöglichte mir, Probleme oder Konflikte mitzubekommen, an denen sich beispielsweise Hierarchien ablesen lassen, oder Verwerfungen bereits entwickelter Materialien – hier können beispielsweise an den Motiven solcher Verwerfungen Konzepte zu ästhetischen Standards abgelesen werden.
Darüber hinaus hinterließ dieses Mitbekommen zahlreicher Wiederholungen in den Proben und dieses Involviert-Sein Spuren in meiner Wahrnehmung und meiner Vertrautheit mit dem Material. Vor allem die Bewegungsqualität einzelner Personen, Szenen oder ganzer Produktionen wurde dabei zu einer wahrnehmbaren Qualität für mich, die ich nur so mit in die Analyse einfließen lassen konnte.
Mit meinem methodologischen Ansatz der bodyscapes (eine ausführliche Diskussion erfolgt in Kapitel 3.4.1) geht auch einher, dass ich den Körperbezug auch auf mein eigenes methodisches Vorgehen hin mitreflektiere. Es geht also auch hier darum, mich selbst im Prozess meiner Forschung und Wissensgenerierung als körperlich zu denken. In der Ethnologie wird oft die Relevanz des sogenannten tacit knowledge betont, eine Wissensform, die sich nicht über versprachlichte Prozesse erschließt, sondern durch die Anwesenheit des/der ForscherIn.{54} Von dieser Definition ausgehend, verfolge ich aber kein ontologisches Körperverständnis, in dem der Körper als unmittelbarer Empfänger von Wissen gedacht ist, wie das stellenweise in Theoretisierungen von der körperlichen Anwesenheit des/der EthnographIn geschieht.{55} Vielmehr geht es mir darum, Bereiche in die Wissensgenerierung mit einzubeziehen, die Wissensvorstellungen nicht entlang von Paradigmen wie Objektivität, Rationalität etc. denkt. Wenn ich beispielsweise meine Wahrnehmung als Forschungsinstrument einsetze, dann denke ich den Körper hier nicht essentialistisch, das heißt ich schreibe ihm keine a-kulturelle, universelle Kommunikations- oder gar Erkenntnisfähigkeit zu.{56} Vielmehr platziert mich der Fokus auf somatische, affektive, emotionale Reaktionen im Forschungsprozess als „corporeal being who critically engages with the  …
…  dancing body”{57}.
dancing body”{57}.
Das Zusammenspiel von sozialen Strukturen, Körperlichkeit und ästhetischen Strategien ergab in jeder Produktion mit ihren täglichen Ritualen, Arbeitsweisen, Orten und Menschen eine spezifische Stimmung, durch die sich die einzelnen Produktionsprozesse deutlich unterschieden. Oft hatte ich das Gefühl „die Produktion“ gut zu kennen, ohne das an etwas Bestimmtem festmachen zu können. Die Theaterwissenschaftlerin Sabine Schouten beschäftigt sich in ihrer Untersuchung Sinnliches spüren – Wahrnehmung und Erzeugung von Atmosphäre im Theater{58} mit der Art und Weise, wie in Aufführungen solche Stimmungen beziehungsweise Atmosphären erzeugt und wahrgenommen werden. Das Wahrnehmen einer Atmosphäre siedelt sie dabei in der affektiven Betroffenheit der einzelnen Personen an, wobei der Wahrnehmungsprozess sich immer aus dem Zusammenspiel verschiedener Sinneseindrücke ergibt. Die Besonderheit des Wahrnehmungsprozesses „liegt  ...
...  in der engen Verknüpfung des atmosphärischen Spürens mit der eigenen Körpererfahrung im Sinne von Spannungs-, Erregungs-, Lust- oder Unlustzuständen.“{59}
in der engen Verknüpfung des atmosphärischen Spürens mit der eigenen Körpererfahrung im Sinne von Spannungs-, Erregungs-, Lust- oder Unlustzuständen.“{59}
Die durch die Teilnehmende Beobachtung gewonnenen Eindrücke dokumentierte ich in Form von Feldnotizen. Die Feldnotizen bestehen aus einer Mischung deskriptiver Beschreibungen von Situationen, theoretischer Überlegungen und Tagebucheinträgen sowie aus Notizen organisatorischer und logistischer Art wie Beispielsweise Zeitplänen oder Regiebucheinträgen.{60} Als einen Bestandteil dieser Feldnotizen habe ich in den Forschungssequenzen ein somatisches Tagebuch geführt, in dem ich mich vor allem auf meine körperlichen und emotionalen Reaktionen und Empfindungen beziehe. Ich konnte so durch das Wahrnehmen einer Atmosphäre ein Gefühl für Arbeitsweisen der einzelnen ChoreographInnen entwickeln, sowohl bezogen auf die Auswahl des choreographischen Materials als auch bezogen auf wiederkehrende Situationen und Dynamiken. Diese Besonderheiten haben auch immer politische Implikationen: Sie stehen in Verbindung mit Hierarchien im Produktionsprozess, mit Erwartungen und mit Zugängen und Möglichkeiten der einzelnen Beteiligten.
Damit geht immer auch einher, dass ich meine eigenen Annahmen, Stereotype, Interessen und auch meine eigene Körperpraxis und Rezeptionspraxis mitdenke und berücksichtige, dass meine Beobachtungen und Interpretationen immer auf der Grundlage meiner eigenen körperlichen Vorerfahrung und Rezeptionserfahrung geschehen. Ich begreife mich selbst als Forscherin immer auch als diskursives Gebilde. Meine persönlichen Interessen, Ziele, Erfahrungen, mein Vorwissen, meine Rolle im Gesamtgefüge der Produktionen spielen hier eine zentrale Rolle und müssen mitgedacht werden.{61}
Kontaktflächen, Konstellation # 3
Die dritte Konstellation an Kontaktflächen beziehe ich auf die Aufführung. Dabei greifen ästhetische Analyse der Stücke und Analysen des Raumes, der im Moment der Aufführung entsteht, ineinander. Im Zentrum steht der performative Raum der Aufführung,{62} in dem sich Konstellationen an Kontaktflächen aus ZuschauerInnen, dem Geschehen auf der Bühne und darüber hinaus auch aus Rahmungselemente wie Spielorte, Programmhefte etc. vernetzen.
Oft geht es hier um Vorstellungen, Erfahrungen und Festlegungen von Teilen von Welt und somit auch um die Herstellung von Welt durch die spezifische Beziehung ihrer Bausteine. Als Ausgangspunkt für diese dritte Konstellation an Kontaktflächen beschäftige ich mich mit Positionierungen und Erfahrungen des Publikums. Hier spielen Prozesse der Wahrnehmung eine wichtige Rolle.
Forschungsschritte und Datensätze
Ich war selbst bei den Aufführungen der Stücke mehrmals anwesend und habe dadurch die Bühnenversionen sehr oft gesehen und unterschiedliche Publikumskonstellationen mitbekommen.
Darüber hinaus habe ich nach allen untersuchten Projekten in Form standardisierter Fragebögen alle ZuschauerInnen, die sich zu dieser Befragung bereit erklärten, assoziativ nach ihrem Erleben des Stückes befragt. Diese Befragungen erfolgten schriftlich, so dass ich möglichst viele ZuschauerInnen befragen konnte. Das sample, also die Auswahl der InterviewpartnerInnen war zufällig ausgewählt.{63} Die Fragebögen glichen sich in ihrem inhaltlichen Aufbau, ich habe sie aber je nach Stück variiert und einzelne Fragen angepasst. Dabei verfolge ich nicht den Ansatz einer repräsentativen Publikumsstudie, die Aussagen darüber treffen möchte, wie ein Stück vom Publikum „allgemein“ wahrgenommen wird – liegt solchen Fragen doch ein Kunstbegriff wie auch ein Wahrnehmungsbegriff zugrunde, der sehr deterministisch gedacht ist. Vielmehr habe ich die Antworten einerseits dafür verwendet, Kategorien zu entwickeln und andererseits dahingehend ausgewertet, dass sie Ausgangspunkte für Fragen bilden. Denn durch die Befragung soll auch wiederum kein deterministischer Übersetzungsbegriff von Erfahrung zur Sprache verfolgt werden. Ich benutze die Äußerungen des Publikums um Ausgangspunkte zu finden, die auch in Hinblick auf die im Stück vorhandenen Inszenierungsstrategien fruchtbar gemacht werden können.{64}
Читать дальше
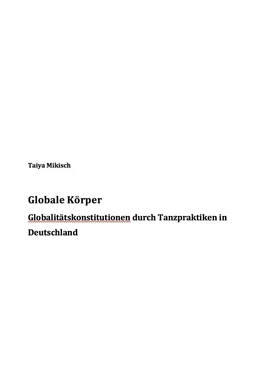
 …
…  dancing body”{57}.
dancing body”{57}.