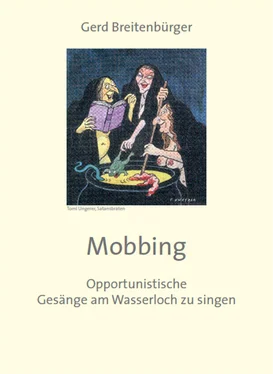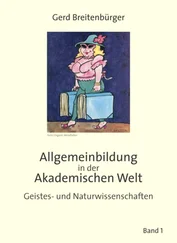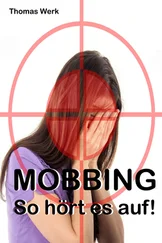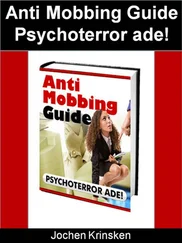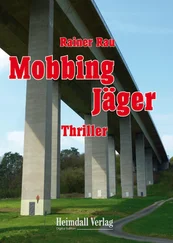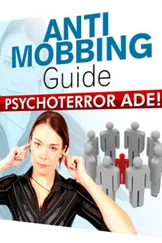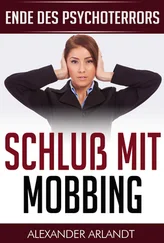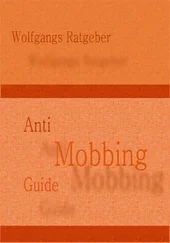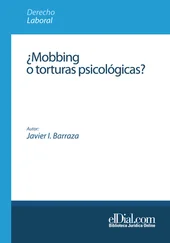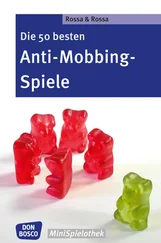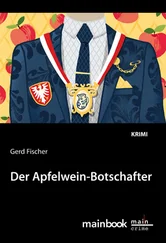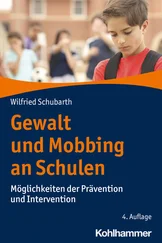In den meisten Fällen ist die berufliche Position keine Sackgasse für die Existenz, aber wohl ein Hemmnis, noch immer den Geist der Freiheit zu spüren, die bekannte Aufbruchsstimmung der jungen Jahre. Das bedeutet, dass, wenn erst einmal der gewohnte Widerstandskoeffizient des Lebens (so der Philosoph Jean-Paul Sartre), etwa der normale Lebens- und Leidensdruck ist gemeint, sich durch zusätzliche Frustration ins Unerträgliche steigert, die Frage nach Alternativen lebenswichtig wird, und zwar für die Physis wie für die seelische Gesundheit. Wer sie findet oder hat, findet in ihnen eine Art Rettung und den Trost und vermindert so ganz erheblich die nervliche Belastung. „Dann gehe ich eben nach Wuppertal. » Das könnte die Rettung sein, weil man sich denkt, dass damit der Stress der jetzigen Situation abgebaut wird. Disstress, langer und starker Stress, ist, wie man weiß, ein gefürchteter Krankmacher, der meist mit Schlaf- und Konzentrationsstörungen seinen Anfang nimmt. Es geht da schließlich um Geist, Körper, Seele und Normalität.
Das Opfer kann durch das, was man in Analogie zum organisierten Verbrechen organisiertes Mobbing nennen muss, vollständig in die Zange genommen werden. Nicht nur unangenehm, auch gefährlich ist der Umstand, dass in dieser Situation das Denkvermögen in Mitleidenschaft gezogen wird, auf das es jetzt besonders ankäme. Angstgefühle engen das Nachdenken und die Entschlusskraft ein.
Wenn die Welt noch in Ordnung ist, hat man einen ruhigen Schlaf, keine Pistole unter dem Kopfkissen, spürt die Garantie, dass das, was man heute sein Eigen nennt, nämlich Weib und Acker, auch morgen noch besitzt. Man weiß zu schätzen, am Lebensende nicht mit einer eisernen Ration für immer in den tiefen Wald, wie schon mal früher bei manchen Indianern üblich, verabschiedet zu werden, ohne Aussicht auf Wiederkehr. Es wird einem nicht vorgelogen, die Dinge seien so und so und heimlich geschieht dann doch das Gegenteil. Dies sind einige Umschreibungen von frühzeitlichen Regeln, die der Ethologe Irenäus Eibl Eibesfeldt als moral-analoges Verhalten schon im Tierreich ausmacht. Schon dort also die Sehnsucht, die wir heute auch haben, nach den Segnungen von Regulierung und Sitte. Das wäre das alte Lied. Wer in chaotischen Verhältnissen leben muss, ist reif für eine geordnete Welt. Er strebt danach. Er widmet dieser Aufgabe sein ganzes Leben wie der Staatsphilosoph aus China, Konfuzius. Ein wenig sind wir immer noch in der Gilgamesch-Situation. Das Chaos hinter uns treibt uns in die Sehnsucht nach der Utopie, die wir nicht erreichen. Im Gegenteil, wir müssen uns Gedanken über die Effizienz von Aggression und Mobbing machen. Wir sind unsere eigenen Antikörper, wir sind es selbst, die unser Immunsystem angreifen und knacken. Weder die Naturwissenschaftler noch die Bluttransfusionen aus der kreativen Geisteswelt scheinen eine Chance zu haben, da wir es fertigbringen, uns selbst zu mobben statt uns ein Hängemattenleben zu gönnen. Wer gemobbt wird, wird dem besonders freudig zustimmen und sich weitere Regeln vorstellen können. Der Konsens aller würde dem Mobbing den Garaus machen. Was aber Solidarität bedeutet, lässt sich schon mal im Großraumbüro beobachten.
Das einzellige Pantoffeltierchen reagiert auf Widerstand, zieht sich zurück und geht dann in einer veränderten Richtung wieder vorwärts. Eine schwache Form von trial and error , aber irgendwie musste sie erfunden werden. Der Mensch spürte geradezu, dass es günstiges Verhalten gibt und bezeichnete es mit „gut“. Damit war das Schicksal von Chaos und Totschlag, Raub und Diebstahl und Mobbing besiegelt, zumindest der Einschätzung nach. Wenn der Mensch einmal das findet, was ihm als „gut“ einleuchtet, wird er daran festhalten, jetzt schon 5000 Jahre lang. Worauf sich diese Einschätzung bezieht, welche Inhalte gemeint sind, kann variieren. Aber diese Trias scheint nötig zu sein, um Gruppen und Gesellschaften stabil zu halten. Sie müssen wissen, was erlaubt ist und also allgemeine Zustimmung erfährt. Es muss einen Weg geben, über gewohnheitsmäßige Vermeidungsstrategien, Schweinfleisch essen wir nicht aus hygienischen Gründen, zu Tabus und zu Regulierungen zu kommen. Mobbing liegt dazwischen, man weiß, das und das ist verboten und in einer Grauzone liegt das, was einmal verboten werden könnte. Es ist eine Kampfzone, in der die Handlungen des Menschen jeweils das aus- und durchspielen, was eben nicht unter seine klaren Regelungen fällt. Es gibt Kampf, der regulär ist und für den es häufig auch einen Richter und Kampfrichter gibt. Und dann den regellosen Kampf, im Sport recht selten, im gesellschaftlichen Leben sehr häufig. Eine beliebte Beimischung, wie der Pfeifenraucher seinen Würztabak, sein Latakia liebt. Sie wird Mobbing genannt und hat einen Grenzwert, die Kriminalität, und einen Ausgangswert, nämlich Freundlichkeit, wie sie unter Menschen normal sein sollte.
2.4 Arbeits- und Machtkampf
Ein Kampf kann fair sein, die Menschen spüren, wenn er unfair ist. Das ist immer der Fall, wenn Regeln, die ja für alle verbindlich sein sollen, nicht eingehalten werden. Der Tiefschlag beim Boxen oder an die Nieren. Kampf, nicht der kultivierte Streit im gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, verlässt die rationale Argumentationskultur. Der Arbeitskampf bis zur Sabotage erlaubt Emotionen und auch Zielsetzungen, die den Charakter von Mobbing haben können, wenn zum Beispiel Machtpositionen gestärkt werden sollen. Er erlaubt nicht, muss aber hinnehmen, dass fragwürdige Methoden wie Sabotage eingesetzt werden, die die dringend benötigte Leistung für den Betrieb nicht zu erbringen erlaubt. Der Machtkampf mit dem Chef, der Kampf, wer grenzt wen aus, wer erobert und kontrolliert die Informationswege, wer erobert die Stelle und die Befugnisse, wer erhält in zähen Verhandlungen in Politik, Wirtschaft und Vereinen die Vormacht, wer behält schließlich auch noch in den Dominanzkämpfen der Familie die Oberhand. Das kann man auch Gezerre nennen oder Technik von Heckenschützen. Kurioserweise kann man Zeitungsartikeln entnehmen, wie sensibel man ist, Mobbing auch noch bei milliardenschweren Wirtschaftsverhandlungen, bei denen es nicht ums Verhungern geht, auszumachen, wenn ein Verhandlungsführer ohne Ankündigung zu einer wichtigen Verhandlung einfach nicht erscheint oder bei der psychologischen Kriegsführung, wenn ein Großmeister sich nach einem vielleicht unsicheren Zug bei einem Schachturnier triumphierend zurücklehnt.
Wer über Mobbingmethoden nachdenkt, wird automatisch gedrängt, herauszufinden, wie sie wirken. Sie greifen handelnd in die Realität des Opfers ein, der wichtige Aktenordner ist verschwunden. Aber meist ist der Realitätseingriff nicht das eigentliche Ziel, sondern die Ängstigung, auch schon mal die Panik, die Ich-Schwächung und Destabilisierung, die Depression und das Misstrauen, sogar der Verfolgungswahn. Über sie will der Täter zum Ziel kommen, weich klopfen ist da ein viel zu schwacher Ausdruck. Macht gibt es nicht kiloweise und ist nicht stapelfähig. Sie wird erlebt, wie aus spontanen und selbstverständlichen Reaktionen bedrückende Ratlosigkeit wird. Die Zangenbewegung des Stärkeren führt zu einer unerwarteten Lebenssituation, in der unreflektierte Anpassung, die nicht mehr frei reflektiert werden kann, da ohne Freiheitsgrade, eingefordert wird.
2.5 Mobbing und Anpassung
Wenn es um Anpassung geht, werden schon mal Mobbing-Methoden eingesetzt, die über den Entzug jeder Zuwendung, die das Kind oder den Partner lenkt einerseits bis zur harten und fühlbaren Bestrafung gehen. Wer in seiner Gruppe kaltgestellt wird, muss sein Verhalten ändern oder sie verlassen. In der Natur verläuft Anpassung schmerzlos, als ein Prozess, der seine Zeit beansprucht. Der weiße Schmetterling, der gewohnheitsmäßig die weiße Birke besucht, passt sich nur langsam genetisch an die Birke an und wird tiefgrau über dem Vererbungsweg und mit Hilfe passender Mutationen, wenn die Birke sich in der Industrieverschmutzung mit der Zeit verfärbt. Schmerzlos aber sehr langsam ist dieser Prozess, der in der Kultur schon mal sehr schnell eingefordert werden kann. „Entweder du hörst auf, vom Nachbarn abzuschreiben oder du fliegst raus.“ Alle mogeln, nur er muss sich jetzt an die Regeln anpassen. Die „schwarze Pädagogik“ war da schon mal von unerbittlicher Härte und aus heutiger Sicht auch noch von zielsicherer Negativität. Man muss eher von Mobbing sprechen als von einer positiven pädagogischen Leistung seitens der Erzieher. Die Technik des Anprangerns wurde praktiziert und bewirkte seit der Antike sklavische, angstbetonte Anpassung oder die Zerstörung der Persönlichkeit. Die Unerbittlichkeit, mit der in manchen asiatischen Kulturen darum gekämpft wird, das Gesicht nicht zu verlieren, führt oftmals zu der Übertreibung, immer nur Recht behalten zu müssen, selbst noch bei der Frage, haben wir heute Dienstag oder Mittwoch. Demütigung beginnt da schon im sehr Kleinen und ist ein Einfallstor für Schlimmeres, für Mobbing dessen, der eine erste Schwäche gezeigt hat.
Читать дальше