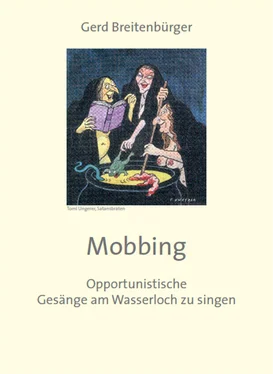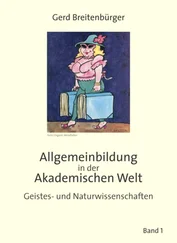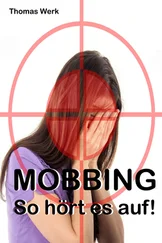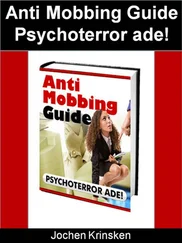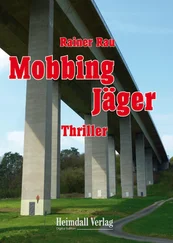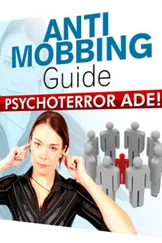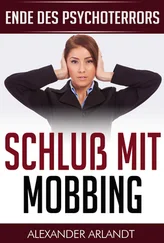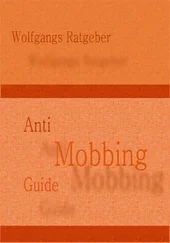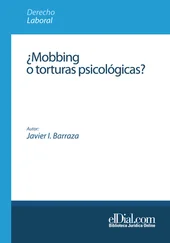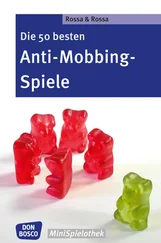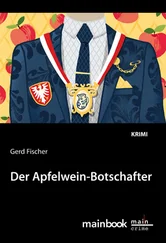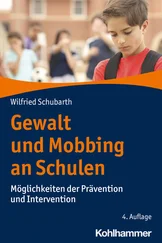Zur Selbstbehauptung gehört die Bereitschaft zur Aggressivität, das war schon immer so und wird voraussichtlich so bleiben. Insofern invariant, aber deswegen liegt noch lange nicht eine Determination vor, bei der keine Alternative zugelassen ist. Von ihr spricht man, wenn ganz tief angelegt die Erbstruktur, also die DNS, die Eigenschaften des Menschen bestimmt und nur im Rahmen von Jahrhunderttausenden offen für Mutationen ist. Es lässt sich denken, dass konstantes Verhalten sich so gut durch die Zeit durchhält, weil es vorteilhaft ist, das nennt man auch ökonomisch. Wenn es nicht immer neu erfunden werden muss. Aber ausgeschlossen sind Verhaltensänderungen nicht. Einmal erzieht man die Kinder im häuslichen Nest, dann in der Kita. Mit ganz anderen Ergebnissen. Daraus leitet man den Optimismus ab, dass sich der Mensch in einem gradualistischen Prozess moralisch verbessern könnte. Mobbing und Aggressivität, auch wenn sie einen erheblichen natürlichen Anteil haben, also neurophysiologisch nachweisbar sind, könnte der Mensch als eine Herausforderung an seine Kultur ansehen, die das Denken in Alternativen, auch moralischen, stimuliert. Wenn die Kinder nur partiell die Verhaltensregeln der Eltern übernehmen, verursacht das einen höheren Aufwand an Energie, aber der ist gerade typisch auch für Prozesse der Erneuerung, der Kreativität. Zum Nulltarif ist das Leben nicht zu haben, wir müssen immer mit seinem „Widerstanstandskoeffizienten“ (Jean-Paul Sartre) rechnen, prinzipiell, und dann noch mit zusätzlichen unerwünschten Ereignissen. Vielleicht ist ja eine gewisse Indolenz, eine anerzogene Schmerzunempfindlichkeit gegen unser Anspruchsdenken bzw. daraus folgende Frustrationen sinnvoll. Das bedeutet, dass wir überlegen mit unserer Bedürfnispyramide umzugehen bereit sind. Was ist dann menschlich? Nicht historisch sich ergebende Verhaltensschemata wären es, sondern die Kunst, bei der Autopoiesis, der Selbstgestaltung ein immer glücklicheres Händchen zu entwickeln. Die Verfolgung von Glück, The pursuit of happiness, als Leistung des Einzelnen dorthin, müsste bei allen Bremsklötzen zu realisieren sein. Wenn nicht, wäre unser Optimismus töricht, blind und eine hoffnungslose Selbsttäuschung. Beim Mobbing könnte man ja anfangen. Darauf könnte man doch hoffentlich leichter verzichten als auf Giftmord und sexuelle Nötigung. Aber bei unserer jetzigen condition humaine kombinieren wir auch noch beides, die Heimtücke und dann das Strafgesetzbuch.
Die Phantasie, sich im geistigen Möglichkeitsraum zu bewegen, wird aktiviert und widerspricht einem Verhalten, das von Determinanten festgelegt wäre. Das heißt, der Mensch wird nicht immer oder ausschließlich von seinen Bedingungen bestimmt, wie der Zugvogel von seinem Programm, immer nach Südafrika fliegen zu müssen. Er kann in einem bestimmten Rahmen bewerten und entscheiden. Insofern kann man bei ihm von Autonomie sprechen, von Freiheit. Der Fußballer Rechtsaußen wird zum königlich-kaiserlichen Vorbild für die Jugend ernannt. Die Umstände, wie er erfolgreich Fußball spielt und wie er smart vor einem begeisterten Publikum auftritt, legen ihn aber nicht fest. Sie sind zwar seine Herausforderung, diese Rolle hoch zu bewerten und auszufüllen, über Jahrzehnte. Ein Verhaltenschema kann aber geändert werden. Der Versuchung kann der Rechtsaußen und jeder andere aber erliegen, es anders, auch unmoralisch zu machen. Hätten wir einen Determinismus, der uns, als seien wir eine Maschine oder Marionette, immer festlegt, die zehn Gebote einzuhalten, würden wir die Gebote gar nicht brauchen und auch nicht kennen. Jedes Gebot, jede moralische Regel ist eine Erinnerung daran, dass wir sie bitter nötig haben.
Die Handlungen des Menschen bewerten wir. Sind sie verwerflich oder können wir sie rechtfertigen. Eine Kultur, in der das nicht verlangt wird, können wir utopisch nennen. In ihr handelt der Mensch immer richtig. Das könnten wir uns auch jetzt schon wünschen und müssten dann die Frage beantworten, wie werden wir Aggressivität und Mobbing los. Wie den Opportunismus, diesen Egoismus, den wir nicht selten bis zum äußersten zu verfolgen bereit sind. Wenn wir darauf eine Antwort finden könnten, müssten wir nicht die 2700 Utopien lesen, die der Mensch seit der Antike zu diesem Thema geschrieben hat. Die Handlungen, die Techniken und Methoden, mit denen wir dem Nächsten das Leben schwer machen, sind dagegen nicht besonders kompliziert und wohl leicht zu lernen. Erschreckend leicht zu lernen, so dass jeder Flachkopf sie beherrscht. Auch die Gründe, aus denen heraus geschnitten und verleumdet wird, sind durchschaubar. Keinesfalls aber sind die Folgen abzusehen, die mit solchen Aktionen angerichtet werden. Man kann die Gründe für einen Amoklauf benennen. Man kann ihn aber nicht voraussehen. Man kann einen Mitmenschen bis zur Verzweiflung und zum Selbstmord treiben. Wie er schließlich reagiert, liegt aber bei ihm.
1.2 Das ökonomische Prinzip
Wer effizient wirtschaften will, wendet das ökonomische Prinzip an. Mit minimalen Kosten soll gewirtschaftet werden, alles andere wäre Verschwendung. Wer seinen Input kennt, 100 EUR, rechnet mit einem maximalen Out-put. Auf der Ebene der einfachen Physik kennen wir das Hebelgesetz. Mit leichter Kraftanstrengung bewegen wir die Schwergewichte und steter Tropfen höhlt den Stein. In der Chaostheorie spricht man von der bescheidenen Ursache, die einen Hurrikan auslöst. Von der Physik und Natur geht es zum komplexen menschlichen Handeln. Als in einem Roman von Max Frisch der Ehemann nach knapp 10 Jahren aus der Fremdenlegion nach Hause kommt, fragt seine Frau als erstes und auch als letztes: „Wo kommst du her?“ Er dreht sich auf dem Absatz um und kommt dieses Mal nie wieder zurück. Ein Wort hat Macht, mit einem Wort gibt man dem anderen Macht über sich. Ein schwach gehauchtes „ja“ und die Folgen sind die, wie die Chaostheorie sie beschreibt. Eben fulminant. Mobbing entwickelt die Macht eines Hebels, worin auch immer ein Faszinosum liegt. Dreißig Jahre lang knistert er beim Frühstück mit dem Brötchen, was sie schwer erträgt und jeden Morgen moniert. Sie löst das Mobbingproblem mit einem kurzstieligen Beil, das sie an einem Tischbein deponiert hatte, zieht ihm den Scheitel mittig und erlebt später das Entgegenkommen eines britischen Gerichts, das sie freispricht. Es gibt hier eine „Royal Society for The Prevention of Cruelty to Animals”, die man wohl auf die Täterin bezogen hat.
1.2.1 Der pessimistische Ansatz
Hier liegt ein pessimistischer Ansatz unserer Kultur, und dieser Ansatz ist ein praktischer, wie wir unsere Welt gestalten und auf sie reagieren. Der Mensch hat nicht nur eine Geschichte, er hat auch immer gehofft, eine Entwicklungsgeschichte, eine kulturelle Evolution zum Besseren zu besitzen. Die Christenverfolgung im antiken Kolosseum hat aber eine Dimension der Grausamkeit, die von einem modernen Krieg leicht überboten wird. Solche Konstanten im menschlichen Wesen lassen vermuten, dass gerade da, wo wir hoffen und auch hoffen müssen, wir könnten sie verlernen, auch unser Pessimismus eine Konstante sein dürfte.
Ab dem 2. Lebensjahr, so der Verhaltensforscher und Anthropologe Michael Tomasello, weiß das Menschenkind, wie es seinesgleichen ärgern kann, was man später auch grillen nennt. Mit dem Gewissen ist es noch nicht so weit her, sadistische Freude liegt näher, die eher daraus entspringt, dass Empathie ein Empfinden ist, das der Mensch erst entwickeln muss. Wenn hier Kultur zu erwachen beginnt, dann ist die Natur, die hier kontrolliert werden müsste, noch zu stark und wird immer wieder im folgenden Leben die Oberhand gewinnen können. Sobald im Verhalten des Menschen seine variantenreiche Kultur eine Rolle spielt, und das wünschen wir uns ja auch, bekommen wir es mit den Invarianten zu tun, über die sich der Anthropologe freut, weil er so den Menschen wiedererkennen kann. Und der Kulturwissenschaftler verzweifelt, weil die Invarianten, die etwas Fundamentales sind, also die Bereitschaft zur Aggressivität etwa, eben nicht ausgerottet werden können und der Kultur entgegen zu stehen scheinen.
Читать дальше