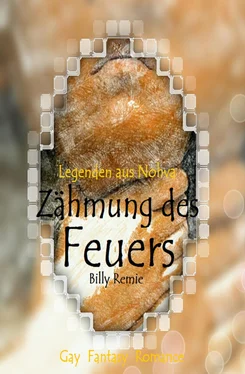Cohen erwiderte das Nicken.
So nah an der Tür, wurde das Flüstern in seinem Kopf so laut, dass es fast die Schreie dahinter übertönte. Noch immer war ihm die Sprache fremd, aber aus einem plötzlichen Wissen heraus, wie ein tief sitzender Instinkt, der sich ihm aus tiefsten Inneren aufdrängte, glaubte er nun, den Sinn zu verstehen.
»Udmm lporou.«
Komm näher.
Ihm wurde die Tür geöffnet. Er blinzelte seine Verwirrung fort.
Was er dahinter sah, ließ ihn angstvoll schlucken. Ein Mann, groß und muskulös – obwohl er über Monate lang gehungert hatte und gefoltert wurde – lag mit dem Rücken auf einer Streckbank. Er war nackt und Schweiß überzog seine ausgeprägten Muskeln und Sehnen, die durch die Folter angespannt waren und deutlich hervortraten. Die Augen des Gefangenen waren weit aufgerissen, sie zeugten von unbändiger Furcht, ebenso von einem zornigen Feuer, vor dem sich Cohen mehr fürchtete als vor den ganzen Folterinstrumenten, die an den Wänden hingen und auf Tischen bereitlagen, damit er sie an diesem ihm ausgelieferten Mann anwenden konnte.
Die Streckbank war eine von König Rahffs bevorzugtesten Foltermethoden. Sie ähnelte in ihrer Form einem langen Tisch, auf dem der Gefolterte sich auf den Rücken legte, Arme über den Kopf, und die Fußknöchel zusammen. Die Arme hingen an einer Art »Stock«, der wiederum mittels Seil an einer Kurbel befestigt war, während die Füße mit schweren Ketten am anderen Ende der Streckband mit dem Boden verbunden blieben. Der Folterer musste nur die Kurbel betätigen und schon wurde der Gefangene – wie der Name des Geräts bereits verriet – gestreckt. Oder besser gesagt, er wurde langgezogen, bis die Knochen knackten.
Cohen stand einige Zeit einfach da und sah zu, ohne in der Lage zu sein, auf sich aufmerksam zu machen. Das Flüstern wurde immer übermächtiger, und er vermochte kaum, es wieder zu vertreiben. Es bereitete ihm Sorgen, dass er es überhaupt hörte.
Was stimmte nicht mit ihm?
»Ikr voigg, ne upllgf mikr rdorol.«
Ich weiß, du kannst mich hören.
Cohen schüttelte den Kopf, um die Worte zu vertreiben.
»Sprichst du jetzt endlich, du jämmerlicher Bastard?«, fragte der Folterer höhnisch.
Cohen mochte ihn auf Anhieb nicht.
Der Gefangene brüllte, sodass Speichelfäden aus seinen rissigen, blutigen Lippen spritzten: »ICH WIEß NICHT, WAS IHR VON MIR WOLLT!«
»Wie du willst.« Der Folterer betätigte die Kurbel.
Entsetzliche Schreie wurden laut, und Cohen musste alle Willenskraft aufbringen, um sich nicht die Ohren zuzuhalten. Das Flüstern wurde zu einem tierischen Aufschrei, dass ihm fast den Schädel zerplatzen ließ.
Die Augen des Gefangenen traten beängstigend heraus, eine Ader platzte und färbte das Weiße in seinem linken Auge rot. Er biss die Zähne zusammen – und da konnte Cohen zum ersten Mal in seinem Leben das furchteinflößende Gebiss eines reinen Luzianers erblicken.
Es hatte Gemälde und Zeichnungen gegeben, die Luzianer mit gebleckten Gebiss zeigten, doch diese hatten bei Weitem nicht so lange und imposante Fänge gehabt wie dieses Exemplar.
Ein reinblutiger Luzianer. Vermutlich der letzte reine Luzianer. Das reinste Blut seines Volkes floss durch seine Adern. Cohen konnte nicht verhindern, dass er so etwas wie Ehrfurcht verspürte.
Cohen schnürte es bei dem Anblick dennoch die Kehle zu und er fasste sich unwillkürlich an den Hals. Ihm war unbehaglich zumute, teils aus Angst, teils, weil er unter seiner Haut ein Kitzeln verspürte, dass ihm unbekannt war.
»Ne gceougf mikr.«
Du spürst mich.
Sein Leben lang wurde ihm beigebracht, die Luzianer zu fürchten, und er verstand nun mehr denn je, weshalb. Aber wie ein Kind empfand er vor dem Unbekannten, eines fast ausgestorbenen Volkes, mehr Neugierde als Furcht.
»Sprich, und du wirst erlöst!«, rief der Folterer über das schmerzerfüllte und wütende Knurren des Luzianers hinweg. »Hast du noch Verbündete? Lebende Verbündete?«
Der Luzianer ließ eine Vielzahl an Flüchen verlauten, die Cohen in dieser Zusammenstellung noch nie vernommen hatte, und die sich größtenteils gegen die Mutter des Folterers richteten.
»F‘dofo« , befahl das Flüstern.
Töte.
Sei doch endlich still, flehte Cohen bei sich.
» Wo befinden sich deine Anhänger, Verräter?«, fragte der Folterer und kurbelte frohen Mutes weiter, ohne auf eine Antwort zu warten.
»ICH WIEß ES NICHT!«, brüllte der Gefangene, und zum ersten Mal war Verzweiflung heraus zu hören. »Ich weiß es nicht, bitte, ich weiß es doch nicht!« Tränen liefen dem Luzianer über die Wangen, als er unter der Folter einknickte. »Bitte, ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Tötet mich einfach …«, erschöpft atmete er aus, » … tötet mich doch einfach.«
Pures Entsetzen machte sich in Cohen breit, als er die flehenden Worte hörte. Eine leise Stimme wurde in ihm wach, die ihm zuflüsterte, dass dieser Mann niemals so etwas gesagt hätte – das er niemals aufgegeben hätte – wenn er wirklich er selbst gewesen wäre.
So viel wusste Cohen bereits aus zahlreichen Gerüchten.
»Genug«, beendete Cohen die Qual des Gefangenen, und bedeutete dem Folterer, die Kurbel loszulassen. Sein Befehl wurde befolgt.
»Ourdouo mikr, Tseogfouou.«
Erhöre mich, Flüsterer.
»Herr, wenn Ihr wünscht, stehe ich Euch bei der Befragung zur Seite«, bat der Folterer, als er bemerkte, dass er abgelöst werden sollte. »Ich kenne diesen Burschen bereits, es wird mir ein Vergnügen sein, Euch seine Schwachpunkte zu zeigen.«
Das widerliche Grinsen in dem Gesicht des Folterers würde Cohen nie vergessen. Es war ihm schleierhaft, wie ein Mann Spaß daran finden konnte, einem anderen Mann Schmerz zuzufügen, wenn dieser sich nicht einmal wehren konnte.
Nur Feiglinge haben Spaß an Folter, so lautete Cohens Meinung dazu.
Der Folterer war ein kleiner Mann mit strohblonden, fettigen Strähnen, die unter seiner braunen Kopfbedeckung hervorlugten. Wenn er grinste, konnte Cohen seine schwarzen, halb abgefaulten Zähne erkennen. Sein Mundgeruch schlug jede Schmeißfliege in die Flucht. Er war dreckig, nicht nur seine einfache Lederbekleidung, sondern auch seine Hände und sein Gesicht, als habe er seit Wochen kein Wasser gesehen.
Cohen versuchte, nicht allzu angewidert drein zu blicken, als er streng ablehnte: »Nein, ich mache das selbst. Geht jetzt und nehmt die königliche Garde mit.«
Er brauchte keine Zuhörer.
Der Folterer blinzelte verdutzt. »Aber, Herr …«
»Habt Ihr nicht gehört?«, herrschte Cohen den Folterer an. »Verschwindet. Das war ein Befehl!«
Sofort kam Bewegung in den sadistischen Schweinehund. Er eilte nach draußen und nahm die Ritter mit.
Cohen legte seinen Umhang ab und warf ihn neben die Folterinstrumente auf einen Tisch. Als sich ihre Schritte entfernten, fühlte er sich weniger überwacht.
Es war kalt in diesem Raum, trotz, dass es kein Fenster gab. Licht spendeten nur vier Fackeln, die an den Wänden links und rechts von ihm angebracht waren. Cohen warf einen Blick auf den Gefangenen, der die Augen fest zusammenpetzte, und dessen schmale Lippen sich bewegten, ohne Worte zu sprechen.
Er war … bildschön.
Nein, wirklich, Cohen fand keine andere, passende Umschreibung für diesen Körper. Selbst gefoltert, und trotz zahlreicher alter Narben, war dieser Körper, der auf der Folterbank ausgestreckt dalag, bildschön. Auf seine raue, männliche Art wahrhaftig schön.
Dunkles Haar, ewig junge Gesichtszüge, die leicht scharfkantig wirkten, dichte Wimpern, gerade Nase, schmale Lippen, die jedoch einen herrlichen Schwung beschrieben. Die Brust war breit, glänzte im Schein der Fackeln feucht von Blut und Schweiß. Zu den Hüften hin wurde der Körper schmäler. Die Schenkel waren wieder breiter und stramm. Das Gehänge … auch schlaff ein Traum, das umhüllt von dunklem Schamhaar in Cohens Augen wirkte wie ein mit begehrenswerten Juwelen gefülltes Vogelnest.
Читать дальше