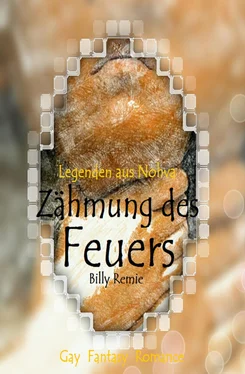All das lag hinter ihm, weit hinter ihm, viele der Menschen, die ihn noch als Jungen gekannt hatten, erinnerten sich vermutlich gar nicht mehr daran. Aber es gab Männer, die konnten die Vergangenheit nicht vergessen, so sehr sie es auch versuchten, und dazu gehörte Cohen. Äußerlich wirkte er immer wie ein grimmiger und strenger Befehlshaber, seine Blicke waren kühl und unnahbar, was die Leute davon abhielt, ihm mit Freundlichkeit zu begegnen, doch das war reiner Selbstschutz. Oft genug hatten Menschen über ihn gelacht, ob offen oder hinter vorgehaltener Hand, weshalb er sie lieber alle auf Abstand hielt. Wenn sie von ihm dachten, er wäre ein reizbarer und stets missmutiger Zeitgenosse, dann war ihm das nur Recht. Alles war besser, als wenn sie wüssten, wie unsicher er eigentlich im Umgang mit anderen Menschen war. Die meisten würden es nur ausnutzen, oder im schlimmsten Fall von ihm denken, er sei kein echter Mann, was ihn zum Zielobjekt intriganter Höflinge gemacht hätte. Vor allem vor Männern wir Cocoun und dessen Vater musste sich Cohen in Acht nehmen. Diese waren nämlich nicht nur sicher im Umgang mit anderen Menschen, sie lebten davon, andere mit Arglist zu hintergehen, zu manipulieren und ihren Charme so auszunutzen, dass alle anderen nach ihren Wünschen und Vorstellungen handelten.
Cohen sagte stets von sich selbst, er besitze keinen Charme, weshalb er auch nicht wusste, wie er anderen Menschen begegnen konnte ohne sie oder sich selbst bloß zu stellen. Sevkin hatte immer liebevoll erwiderte: »Dein Charme sind dein Aussehen und deine tiefgründigen Augen, die jedes Herz im Stillen erobern. Halte einfach deinen Mund, lächle und nicke, dann liegt dir die Welt zu Füßen.«
Sevkin war Cohens genaues Gegenstück gewesen. Sevkin war aufgeschlossen, charmant, humor- und liebevoll. Er konnte mit nur einem einzigen Lächeln und einem schlichten »Wie geht es Euch?« seinem Gegenüber geradezu verzaubern. Gegen Sevkins einmalige Art, die Leute von sich zu überzeugen, kam niemand an. Vermutlich hatte Sevkin deshalb sterben müssen. Weil er es auf seine erstaunlich gewiefte und auch kecke Art bewältigt hätte, alle Feinde des Königshauses mit einem Lächeln zu Befürwortern zu machen. Nur die Familie Schavellen war nicht dem Zauber des jungen Prinzen erlegen gewesen.
Cohen glaubte bis heute, dass Cocoun und dessen Vater eine Falle gestellt haben, in die Sevkin naiver Weise reingefallen war.
Eines Tages, so hatte Cohen geschworen, würden die Verantwortlichen dafür bezahlen. Und wenn die Götter nichts unternahmen, würde er es selbst tun. Er täte nicht nur sich selbst und seinem Vater, sondern auch Nohva einen Gefallen. Und wenn dafür auch er hängen sollte, so war es ihm gleich.
Es gibt, gab und wird nie einen traurigeren Ort als ein vom Krieg zerstörtes und ausgeplündertes Dorf geben, dessen Überreste brannten, während die geschändeten Leichen der einstmaligen Bewohner im aufgeweichten Boden langsam erkalteten. Doch Cohen bemerkte immer wieder erstaunt, wie nah das Grauen im königlichen Kerker dem Grauen an einem vom Krieg gezeichneten Ort kam.
Nicht nur, dass es dunkel, kalt und feucht hier war, sobald man die erste Treppe nach unten genommen hatte, es roch wie in den Abwasserkanälen unterhalb der Burg. Und die Geräusche trugen ihren Teil zu der trostlosen Atmosphäre bei. Wimmern, Weinen und Klageschreie glitten über die kahlen, grauen Gesteinswände, von denen Feuchtigkeit in Rinnsalen hinabrann und sich zu Pfützen auf dem ebenso kahlen, kalten Gesteinsboden sammelte.
Cohen musste an einigen Zellen vorübergehen, die so überfüllt waren, dass er es nicht vermochte, die Männer darin zu zählen. In dreckigen Lumpen, nicht mehr als vergilbte Leinensäcke mit Löchern für Kopf und Arme, die den Gefangenen kaum bis zu den Knien reichten, saßen sie auf dem Boden, der nur notbedürftig mit altem, verschimmelten Stroh bedeckt war. Die Eimer für ihre Ausscheidungen liefen über, sodass sie gezwungen waren, sich in irgendeine Ecke zu erleichtern. Etwas frische Luft drang durch winzige Öffnungen, die mit massiven Stahlstäben vergittert waren und viel zu hoch hingen, als dass es den Gefangenen möglich gewesen wäre, hinauszublicken. Hätten sie es gekonnt, hätten sie lediglich die Rückseite der Kuhställe betrachten können, deren Gestank hereingeweht wurde, wenn der Wind von Norden kam.
Wie jedes Mal, wenn er hier vorbeikam, versuchte Cohen, den Blick strickt zu Boden zu richten und das Elend hier nicht zu betrachten. Er durfte nicht vergessen, dass viele dieser Gefangenen ganz zu Recht hier waren. Es gab skrupellose Mörder unter ihnen, Diebe und Desserteure. Doch Cohen hatte vor allem Mitleid mit den vielen Kriegsgefangenen, die hier auf ihr Schicksal warteten. Unter anderen Umständen hätte er einer von ihnen sein können, oder zumindest in derselben Lage wie sie sein können, hätten seine Feinde ihn überwältigt. Es war doch nur reiner Zufall, dass er bisher immer einen Augenblick schneller gewesen war als seine Gegner. Ohne die Gnade der Götter – wie er annahm – könnte er bereits tot oder ebenso gefangen sein. Zum Teil verdankte er den Umstand, dass er wohlauf und frei war, auch seinen Männern. Er sagte es ihnen leider viel zu selten, weil er eben selten die richtigen Worte fand.
Cohen ging eilig an den Zellen vorbei.
Hier unten hörte er zum ersten Mal dieses seltsame Flüstern wieder, das ihn als Kind sehr oft in Träumen heimgesucht hatte. Es waren keine Worte, die er verstehen konnte. Eine ihm fremde Sprache, die mit einer Stimme gesprochen wurde, die er mit einer Schlange vergleichen würde, die sprechen gelernt hatte. Sie wisperte in einer verführerischen Tonlage zu ihm, lockte ihn.
Sein Herz raste. Es fürchtete sich, ebenso wie es neugierig war.
Sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, vorsichtig zu sein und die Stimme auszuschließen, doch seine Beine trugen ihn weiter, immer tiefer in die Eingeweide des Kerkers und der Stimme entgegen. Das Flüstern drang in seinen Verstand ein, es kam nicht von außen. Erst war es nur leise, doch je tiefer er in den Kerker ging, je deutlicher wurde es.
Cohen schob es darauf, dass er seit Sevkins Hinrichtung nicht mehr richtig bei sich war. Er brauchte Schlaf. Umgehend.
Er ging weiter und ignorierte, dass Männer sich hinter den Gittern die Seelen aus dem Leib kotzten. Er hatte schon gehört, dass hier unten eine schlimme Krankheit herrschte, weshalb die Wachen nicht mehr herkommen wollten. Ihn kümmerte das nicht, selbst wenn er krank wurde, so hatte er das Privileg, von den königlichen Heiler auf der Burg Gebrauch zu machen. Außerdem glaubte er nicht daran, dass die Götter ihm eine Krankheit auferlegen würden, die ihn eine Woche lang ans Bett band, denn das würde ja bedeuten, er hätte für eine ganze Woche Frieden und Ruhe – was die Götter ihm nicht gönnen würden.
An der Tür zu einer kleineren, abgesonderten Folterkammer waren draußen zwei gepanzerte Ritter positioniert, die auf ihn warteten. Cohen hatte die Schreie hinter der morschen Holztür bereits durch den gesamten Kerker vernommen. Der gefolterte Mann dahinter hatte noch immer eine kräftige Stimme, animalisch, fast völlig unmenschlich, ein Knurren war herauszuhören, ebenso tierisches Fauchen, bei dem er erst nicht sicher war, ob es tatsächlich von einem Zweibeiner ausgestoßen worden war.
Doch trotz der Lebenskraft in den Lauten hörte Cohen auch, dass die Stimme allmählich brüchig wurde. Matt. Als würde die Kraft aus dem Körper schwinden, zwar nur langsam, aber doch deutlich hörbar. Er hörte auch Angst heraus, doch diese wurde, je größer der Schmerz war, von Zorn überschattet.
Die Ritter schenkten Cohen ein respektvolles Nicken, mehr konnte und würde er von ihnen auch nie verlangen. Sie sprachen ihn mit »Herr« an, was schon mehr war, als seine Leidensgenossen – die anderen Bastarde – erwarten konnten.
Читать дальше