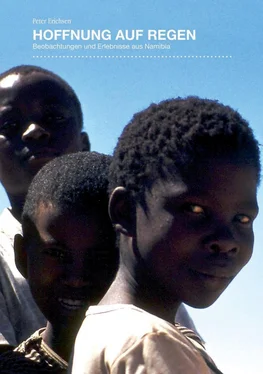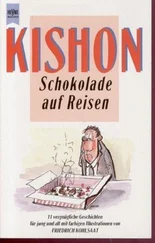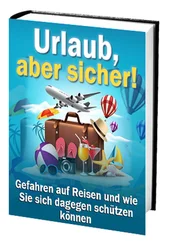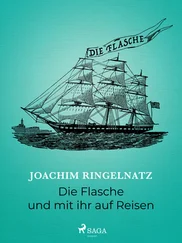15 Kilometer vom nächsten Nachbarn, 40 Kilometer vom nächsten Ort entfernt – an städtisches oder gar großstädtisches Leben ist nicht zu denken. Wo Geselligkeit selten ist, werden offizielle Anlässe wie die Beerdigungen zum gesellschaftlichen Ereignis. Dafür fahren die Leute auch ohne Bedenken 200 Kilometer. Aber die geringe Bevölkerungszahl – deutschsprachige Südwester dürfte es höchstens 20.000 geben – bringt es mit sich, dass sie dennoch unter sich bleiben. Überall kennt man sich, gibt es verwandtschaftliche Beziehungen – eine solche Gemeinschaft ändert sich nur langsam, lässt nur nach heftigem Abwehrkampf Neues oder Fremdes an sich heran.
Der gesamten südlichen Fassade des Hauses war ursprünglich eine lange, überdachte Veranda vorgebaut, die dann später geschlossen wurde. Heute ist es ein langer Flur, von dem aus man sämtliche Räume erreichen kann, die ihrerseits zum Teil noch die alten Fenster haben. Auf diesem Flur sitzen wir oft, wenn wir auf die Mahlzeiten warten. Die Möbel, die Illustrierten auf dem Tisch, die Garderobe an der Wand erinnern mich an ein Wartezimmer beim Arzt. In einer Flurecke steht eine von den mit Petroleum geheizten Tiefkühltruhen.
In diesen Tagen gibt es in den Abendstunden regelrechte Insekteninvasionen. Sie stürzen sich auf uns, setzen sich auf unsere Haut, vom Falter bis zum Kerbtier von der Größe unserer Junikäfer, brummen und summen, dass wir nur noch um uns schlagen. Aber jede Abwehr ist aussichtslos. Wenn wir hastig die klingelnde Haustür hinter uns zugeworfen haben, ist es wieder einer Insektenwolke gelungen, die knappe Öffnung zu nutzen. Wir sollten duldsamer werden, unserer Nerven wegen.
Die Hausfrau sieht es nicht gerne, dass ich mich als Mann in der Küche nützlich mache. Das erklärt, warum ich hier oft allein mit Hinrich und den sonst doch nur störenden Kindern warte. Auch nach dem Essen machen sich die Männer schnell aus dem Staub – aber nur bei mir hinterlässt das ein anerzogen schlechtes Gewissen. Morgens und mittags helfen ein oder zwei „Weiber“ von der Locasi. Die Frau des Hauses lässt kein gutes Haar an ihnen: Sie sind unzuverlässig und dumm. Nur Kinder können sie kriegen – und die sitzen dann oft geduldig vor der Küchentür und warten, bis ihre Mutter fertig ist. Hinrich ist nach Meinung seiner Frau zu gutmütig gegenüber seinen „lieben Negerlein“, hat zu viel Verständnis.
Was sie damit meint, wird klar, wenn wir mit Hinrich allein sind und ihn auf seinen täglichen Kontrollfahrten über die Farm begleiten. Dann legt er seine „Platten“ auf, dann philosophiert er zum soundsovielten Male über Gott und die Welt, und er braucht nicht unbedingt Reaktionen, wenn er so richtig loslegt. Und da für uns alles neu und interessant ist, findet er gute Zuhörer.
So erfahren wir von acht Schülern, die er sich von der benachbarten staatlichen Versuchsfarm geholt hat, zum Maishacken. Die einfachsten Handgriffe muss er immer wieder erklären und einüben, es ist zum Verzweifeln. Händeringend lässt Hinrich sein Steuer los, so sehr erregt ihn das. Aber seine eigenen Leute sind nicht viel besser. Da sollen sie zum Beispiel Mais nachsäen. Aber anstatt nun Reihe für Reihe systematisch vorzugehen, laufen sie einfach so ins Feld. Das können sie einfach nicht, dafür haben sie einfach keinen Sinn.
Wir hören von dem jungen Schwarzen, der vorhin den Hofplatz harkte: Er ist Vater zweier Kinder und ist mit seiner Familie vor einiger Zeit von einer benachbarten Farm gekommen (50 km). Als die Frau Heimweh bekam, schickte er sie und die Kinder „in den Tabak“ und nahm sich eine 16-Jährige von der Locasi.
Oder die Geschichte von Paul: Ein guter Arbeiter (das gibt es also auch!), seit acht Jahren auf der Farm. Aber seine vitale Frau macht ihn systematisch kaputt, sie geht fremd. Eines Tages schließt sie sich als „Marketenderin“ einer politischen Wahlkampftruppe von der DTA (Demokratische Turnhallenallianz) an, herausgeputzt mit Kleid, Hut und Stöckelschuhen. Das gibt ihrem Mann den Rest. Er erklärt seinem Baas: „Mister, ich gehe morgen weg.“ Sprach’s und ward nicht mehr gesehen. Hinrich: „War immer ehrlich, und jetzt hat der Hund meine Drahtzange mitgenommen!“ Das Werkzeug, Wert 20 Rand, findet sich jedoch später wieder an.
Oder die Geschichte von dem „Aussteiger“ Ben, einem Schwarzen aus der Republik, der dort in den Goldminen gutes Geld gemacht hatte und sich einen Goldzahn ins Gebiss bauen ließ. Dann wurde er krank und verließ aus irgendeinem Grunde seine Heimat. Nun lebt er auf Hinrichs Farm als Ziegenhirt, wandelt anspruchslos, fast heiter seiner Herde hinterher, ein Außenseiter, hager, mit einem silbern aussehenden Ring im Ohr und dem Alkohol ergeben. Hinrich hält ihn für sehr intelligent, aber er macht nichts mehr daraus. Immer wenn Ben am Zauntor steht, nach seinem Mister ruft und um 10 Rand Vorschuss bittet, dann weiß der Farmer: Elisabeth ist wieder da und erleichtert die Männer auf der Locasi um ihr bisschen Geld. Einmal bin ich dabei, als Hinrich ihm wenig glaubhaft erklärt, er habe selbst kein Geld, er müsse erst zur Bank. Schließlich gibt er ihm einen kleinen Betrag, und ich hoffe nur, dass es zur Beseitigung eines vorübergehenden Notstands reicht...
Wir spüren: Hinrich beschäftigt sich mit seinen Leuten. Er registriert nicht nur ihr Versagen bei der Beachtung mitteleuropäischer Wertvorstellungen. Er geht weiter, versucht menschliche Dimensionen zu erfassen. Das ist in diesem Land nicht selbstverständlich, wie wir noch oft erfahren werden. Hier ist ein Urteil schnell bei der Hand, oder besser, was die Schwarzen betrifft: Es ist seit vielen Jahrzehnten fertig, seitdem wenig verändert worden.
Theodor Leutwein, erster Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika, hatte noch ein recht ausgewogenes Urteil. Seine 1909 veröffentlichen Erinnerungen enthalten eine Reihe Beispiele dafür. Er wehrt sich sogar gegen Vereinfachungen und Vorurteile, die damals natürlich schon weit verbreitet waren. Spätestens seit den „Eingeborenenaufständen“ 1904-1907, in deren Folge mehr und mehr apartheidstypische Bestimmungen das Nebeneinander regeln, haben intellektuell redliche Einschätzungen keine Chance mehr.
Nachdem in unserer Zeit die Schwarzen Afrikas mit Ausnahme Namibias und Südafrikas ihre Erfahrungen mit einer rechtlichen Unabhängigkeit machen durften und ihre Lern- und Bildungsfähigkeit grundsätzlich nicht mehr angezweifelt werden kann, gibt es eine Neubesinnung. Aber sie setzt sich erschreckend langsam durch in einem Land wie Namibia, in dem die Weißen etwas zu verlieren haben.

Aber wie weit dringt Hinrich vor bei der Erforschung der schwarzen Seele? Weiß er, was man so redet, abends an den Feuern vor den „Pontoks“, wenn man sich unbeobachtet fühlt? Was weiß er von Liebe, Zorn und Wut? Kennt er ihre Geschichten?
Er und seine Frau und die meisten Weißen in diesem Land kennen nur ein Nebeneinander der Rassen. Nie waren sie bereit, miteinander zu leben, ihr Urteil ist von äußerlichen Wahrnehmungen geprägt.
Oft geriet ich in der Folgezeit ungewollt in Gesprächssituationen, die mich darüber belehren sollten, dass ich ein Greenhorn sei und auch eins bleiben würde – ein Dscherrieländer eben, einer von den Neunmalklugen von drüben. „Leb du erst mal zehn Jahre mit den Schwarzen, dann kannst du vielleicht mitreden!“ Mal sollte die Probezeit zehn Jahre dauern, mal sechs, mal zwanzig Jahre, je nachdem, wie verbittert mein Gesprächspartner gerade war, jedenfalls unerreichbar für mich. Meist hatte ich für diese Zurechtweisung gar keinen Anlass gegeben, es sei denn durch meine bloße Anwesenheit.
Und immer deutlicher entlarvte sich das Scheinargument: Keiner von den Südwestern hatte jemals mit den Schwarzen gelebt. Und auch ein Schwarzer hält das kaum für eine realistische Möglichkeit. Nicht nur die Weißen leben „apart“, auch die Schwarzen zeigen kein erkennbares Interesse an den Stämmen der Weißen. Sie sind seit vielen Jahrzehnten daran gewöhnt, von ihnen abhängig zu sein. Ihre besonders auf dem Lande oft hündische Unterwürfigkeit mit ihren Verbeugungen und ihrem ständigen „Ja, Mister! Ja, Missis!“ kam uns vor wie ein automatisiertes Verhalten, mit dem sich leidlich leben lässt und hinter dem man trefflich seine wahre Identität verbergen kann.
Читать дальше