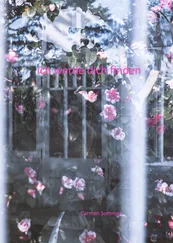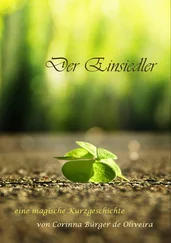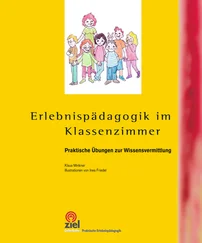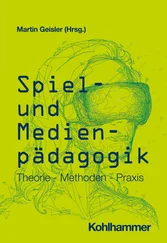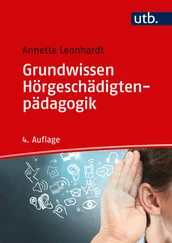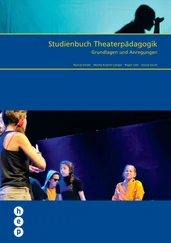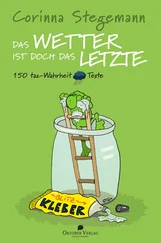Die vier Dimensionen entsprechen wesentlich dem Verhalten, das sich Kinder und Jugendliche von den Erwachsenen und diese sich ebenfalls von ihren erwachsenen Partnern wünschen. Die Haltung und Aktivitäten der vier Dimensionen entsprechen weitgehend der von vielen Menschen angestrebten humanen Lebensqualität (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 103). Aber nicht nur Kinder wünschen sich dieses Verhalten von ihren Eltern, sondern gerade auch Eltern von verhaltensauffälligen Kindern wünschen sich, dass ihre Kinder sich so verhalten.
Entsprechend des lerntheoretischen Modells liegt der Schluss nahe, dass Eltern, die ihren Kindern mit Achtung, Empathie, und Echtheit entgegentreten, dieses Verhalten auch ihren Kindern vermitteln.
Die Auswirkung dieser Verhaltensformen als Grundhaltung der Erziehung und die tatsächlichen positiven Effekte auf die Entwicklung der Kinder sind von Tausch/Tausch empirisch nachgewiesen und in ihrem Werk „Erziehungspsychologie“ detailliert dargestellt worden.
„Die Selbstachtung - das Selbstkonzept - einer Person wird wesentlich gefördert oder beeinträchtigt durch das Ausmaß an Achtung oder Missachtung, das sie von anderen, für sie bedeutsamen Personen erfährt.“ (TAUSCH/TAUSCH, 51f) Auf die Bedeutung des Selbstkonzeptes im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen ist bereits in Kapitel 2.1 hingewiesen worden. Achtung und Wärme sind erheblich förderlich für die Persönlichkeitsentwicklung und für die seelische Gesundheit.
„Ein emotional warmes, akzeptierendes Verhältnis zwischen Eltern und Kind ist auch außerordentlich bedeutsam für den Prozess der Identifikation, der die Normeninternalisierung und damit ein sozialadäquates Leben ermöglicht.“ (MYSCHKER 1999, 156)
Kennzeichen einer von Achtung und Wärme geprägten förderlichen Umgangsweise sind z. B. (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 120):
den Anderen wertschätzen, an ihm Anteil nehmen,
ihm Geltung schenken, ihn anerkennen, ihn willkommen heißen,
mit ihm freundlich und herzlich umgehen,
ihn liebevoll, zärtlich und rücksichtsvoll behandeln,
ihm vertrauen,
sich ihm gegenüber öffnen, ihm nahe sein,
zu ihm halten, ihn beschützen und trösten.
Bedeutsam ist, dass Achtung und Wärme nicht an Bedingungen (z. B. gutes Benehmen, schulische Leistungen etc.) gebunden sein dürfen (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 130), sondern Kindern in jedem Fall entgegengebracht werden müssen. Mehringer (17) stellt dazu fest:
„Aber was diese Kinder ... vor allem brauchen, ist dies: Menschen, die sie so wie sie jetzt sind, als ganze Kinder wahrnehmen, die sie annehmen und mögen - und einen Lebensraum ... mit dieser Atmosphäre des Akzeptiertwerdens.“
3.4.2 Einfühlendes Verstehen
Einfühlendes Verstehen bzw. Empathie beschreibt den Versuch des Erwachsenen, sich in die Gefühlswelt des Kindes einzufühlen. Es ist nach TAUSCH/TAUSCH (178) klar abzugrenzen von einem „bewertenden Diagnostizieren“ oder „analysierenden Erklären“, die heute eher im Mittelpunkt des Verstehens sind.
Die Sinnhaftigkeit dieser Verhaltensweise basiert auf der Erkenntnis, dass jede Person in ihrer eigenen inneren Erlebenswelt lebt, die ihr Verhalten und ihr Selbstkonzept entscheidend (positiv oder negativ) beeinflusst und erklärt. „Eine Person lebt danach, wie sie ihre Umwelt und sich selbst wahrnimmt.“ (TAUSCH/TAUSCH, 178)
Nur wenn man versucht, sich in dieses Erleben einzufühlen, kann es gelingen, die Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen und nicht einfach kategorisch zu verurteilen. Dies ist die notwendige Grundlage für eine Trennung von Tat und Person, die es ermöglicht, auch Schwerstverhaltensauffällige mit Respekt und Würde zu behandeln, statt sie wegen ihres inakzeptablen Verhaltens abzulehnen. Diese Haltung ist gekennzeichnet durch „... ein sensibles, einfühlendes, vorurteilsfreies, nicht-wertendes und genaues Hören der inneren Welt des anderen.“ (TAUSCH/TAUSCH, 179) Durch einen solchen Umgang erlebt das Kind sein Gegenüber als einen geduldigen und ihn akzeptierenden Partner (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 180). Zum einen kann dies zu einer subjektiven Erleichterung und Klärung des inneren Erlebens führen, zum anderen hat es auch positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Wenn man dem Kind vermitteln kann: „Ich verstehe dich, mag dich und akzeptiere dich, so wie du bist“, dann fällt es auch dem Kind wesentlich leichter, sich zu mögen und ein positives Bild von sich zu entwickeln.
„ Echtheit bedeutet in erster Linie: Äußerungen, Verhalten, Maßnahmen, Gestik und Mimik einer Person stimmen mit ihrem inneren Erleben, ihrem Fühlen und Denken überein.“ (TAUSCH/ TAUSCH, 214; Hervorhebungen im Text)
Diese Menschen verstecken sich nicht hinter einer Fassade (Professionalität, Zurückhaltung, Höflichkeit), sondern treten so auf, wie sie sind. Sie leben die Gefühle, die sie empfinden (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 220).
Kennzeichen von Echtheit und Aufrichtigkeit im zwischenmenschlichen Umgang sind u. a. (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 215):
sich so zu geben, wie man wirklich ist,
sich ohne professionelles oder routinemäßiges Gehabe zu geben,
sich aufrichtig, ungekünstelt und natürlich zu verhalten und
keine Rolle zu spielen.
Echtheit ermöglicht den Aufbau von Vertrauen zum Gegenüber, zur eigenen Wahrnehmung und bietet dem Kind klare Strukturen, an denen es sich orientieren kann.
3.4.4 Förderndes und nicht-dirigierendes Handeln
„Diese Tätigkeiten einer Person sind die Folge ihrer gleichzeitigen Haltung von einfühlendem Verstehen, Achtung, Wärme sowie von Echtheit und stehen in Übereinstimmung mit diesen.“ (TAUSCH/ TAUSCH, 244)
Sie sind sozial reversibel, was bedeutet, dass Kinder sich gegenüber Erwachsenen in ähnlicher Weise verhalten dürfen, ohne gegen die Achtung des Erwachsenen zu verstoßen. Sie werden im Gegenteil als wünschenswerte und förderliche Verhaltensweisen angesehen und bereichern die Beziehung.
Es sind Aktivitäten für das Kind, die mit ihm zusammen gemacht werden und nicht gegen das Kind gedacht sind. Zwischen Kind und Erwachsenem besteht Übereinstimmung über den positiven Wert dieser Aktivitäten. Sie erleichtern und fördern das selbstständige, selbstverantwortliche Lernen, setzen selbstbestimmte Tätigkeiten und Kreativität frei und sind für alle Beteiligten förderlich (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 245). Einige Beispiele (vgl. TAUSCH/TAUSCH, 247) für fördernde und nicht-dirigierende Tätigkeiten sind im einzelnen:
sich für den anderen verfügbar halten,
Angebote machen und Anregungen geben,
mit ihm gemeinsame Aktivitäten ausüben,
dem anderen Rückmeldung geben, ihm klärende Konfrontationen ermöglichen,
mit ihm gemeinsame gefühlsmäßig bereichernde Erlebnisse machen.
Ausgangspunkt des folgenden Kapitels sind die Fragen, ob Eltern und Erzieher diese förderlichen Verhaltensformen den Kindern - insbesondere verhaltensauffälligen - in ausreichendem Maße entgegenbringen bzw. entgegenbringen können und ob Hunde sie nicht in diesem Bemühen sinnvoll unterstützen können.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.