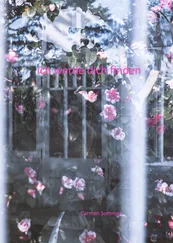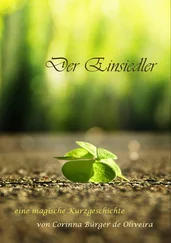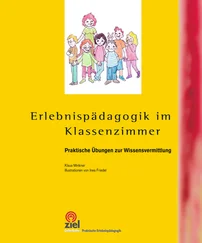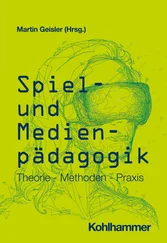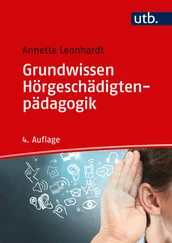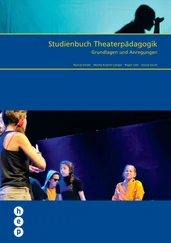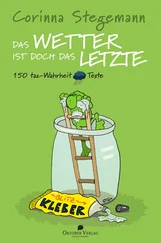Individuumzentrierte Perspektiven sehen verstärkt
medizinische Gegebenheiten (genetische, somatische oder psychopathologische),
tiefenpsychologische Ereignisse (traumatische Erlebnisse) und/oder
lerntheoretische Gründe (Konditionierungs- und Modelllernprozesse) als Ursachen an.
Gesellschaftsorientierte Perspektiven legen den Fokus auf
gesellschaftliche Bedingungen (Arbeitslosigkeit, Armut, Familienstrukturen) und/oder
Erziehungsunsicherheit.
Sozialpsychologische Perspektiven sehen den Grund in
sozialen Interaktionsprozessen (Beziehungs-, Kommunikationsprobleme) und/oder
Etikettierungsprozessen.
Verhaltensstörungen lassen sich aber nicht linear-kausal auf eine einzige Ursache zurückführen, sondern sind immer eine Kombination aus verschiedensten Faktoren.
Dies macht eine systemische und ganzheitlich ausgerichtete Sichtweise von Verhaltensstörungen notwendig (vgl. VERNOOIJ, 38).
Aus dieser systemischen Perspektive ist eine Verhaltensstörung nicht ein Charakteristikum eines Individuums, sondern Merkmal eines komplex vernetzten, gestörten Ökosystems, in dem das Kind als Symptomträger nur ein Element - den identifizierten Patienten - darstellt (vgl. VERNOOIJ, 36).
Verhaltensgestörte Kinder werden von ihrer Umwelt als Außenseiter, Störenfried oder Versager gesehen.
„Von der Umgebung, von der gesamten Öffentlichkeit wird ihnen weit weniger Aufmerksamkeit, Sympathie, Anteilnahme, Hilfsbereitschaft geschenkt als dem organisch geschädigten Kind. (... ) Das verwahrloste, verhaltensgestörte Kind ... ist böse, es >könnte schon, wenn es nur wollte.“ (MEHRINGER, 13; Hervorhebungen im Text)
Durch diese Einschätzung - Etikettierung - (vgl. FENGLER/JANSEN, 209) bekommt das Kind eine neue Rolle, die Rolle des Außenseiters, zugeschrieben, die festlegt, was von ihm erwartet wird bzw. wie es sich zu verhalten hat (vgl. FENGLER/ JANSEN, 200). Die Ablehnung und Ausgrenzung hat für das Kind schwerwiegende Folgen.
Die individualpsychologische Folge ist ein Gefühl der Minderwertigkeit und der persönlichen Unzulänglichkeit, die mit wachsender Unzufriedenheit, Resignation und Verzweiflung mit sich und seiner Umwelt einhergeht. Neben dieser personalen Insuffizienz - die Unfähigkeit, sich selbst zu mögen oder anzunehmen - existiert auch eine soziale Insuffizienz (vgl. FENGLER/JANSEN, 204), die durch die schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert ist.
„Die allgemeinste Konsequenz einer Verhaltensauffälligkeit besteht in der Tatsache, dass die damit belasteten jungen Menschen in ihrem Verhaltensrepertoire Defizite der verschiedensten Art haben, durch die sie den Anforderungen in den jeweiligen Lebenssituationen nicht in vollem Umfang entsprechen können.“ (FENGLER/JANSEN, 200)
Der Verhaltensauffällige leidet an sich selbst (vgl. FENGLER/JANSEN, 190) oder wie Mehringer (13) betont: „Sie sind arm dran, es geht ihnen ... doppelt schlecht, weil sie gefühlsmäßig meist als selbst schuld an ihrem Zustand angesehen werden.“ Ausgrenzungen, Sanktionen und Konflikte nehmen zu, beeinflussen sein Verhalten, Erleben und sein Selbstbild und führen zu einem Teufelskreis (vgl. FENGLER/ JANSEN, 209), aus dem der Betroffene allein nicht mehr herauskommt. Das Endergebnis dieses Prozesses ist die sekundäre Devianz (vgl. LEMERT, 433 - 476, zit. nach FENGLER/JANSEN, 209).
Die personale und soziale Insuffizienz sind der Grund für den existentiellen Konflikt, in dem der Betroffene sich befindet. Dieser Konflikt wird durch das erheblich gestörte Selbstwertgefühl bzw. Selbstkonzept ausgelöst und führt zu einem empfindlich gestörten seelischen Gleichgewicht (vgl. FENGLER/JANSEN, 204ff).
Eine Lösung des Konfliktes zur Beseitigung der intrapsychischen Spannung ist von dem Betroffenen allein aufgrund der starken Interdepenzen zwischen Selbstkonzept, Verhalten, Erleben und der Interaktion mit der Umwelt nicht möglich. Da der Konflikt für das Kind also objektiv nicht zu lösen ist, die Spannungen in der Weise dauerhaft aber nicht ausgehalten werden können, existieren menschliche Abwehrmechanismen (z. B. Regression, Projektion, Kompensation usw.), die die Situation subjektiv erträglicher machen. Der seelische Schutzmechanismus der Kompensation soll als Beispiel und für die Beschreibung des einsetzenden Teufelskreises dienen.
Wenn sich ein Kind permanent negativ bewertet und ausgeschlossen fühlt, versucht es dieses z. B. mit „Kasperei“ in der Klasse, mit Rüpelhaftigkeit oder Angeberei zu kompensieren, um auf diese Weise Aufmerksamkeit und Anerkennung zu erlangen. Diese durch Anna Freud beschriebenen Abwehrmechanismen bewirken zwar zunächst eine subjektive Erleichterung, da sie zu Aufmerksamkeit führen, objektiv aber führen sie zu einer weiteren Verschärfung des Konfliktes (vgl. FENGLER/JANSEN, 207ff). Obwohl kurzfristig die Aufmerksamkeit und Anerkennung gewährt werden, manifestiert sich gleichzeitig langfristig das Bild des Störenfriedes und macht das Kind noch mehr zum Außenseiter.
Moor (289) bemerkt dazu: „Nirgends deutlicher als im Ungehorsam ist die besondere Art des Geltungsbedürfnisses eines Kindes zu erkennen.“
Nachdem - der I. Moorschen Regel folgend - nun Einblick in menschliches Verhalten gegeben und die Gründe für Auffälligkeiten vermittelt wurden, soll jetzt die Bedeutung der Erziehung für den Menschen und seine Entwicklung genauer betrachtet werden.
Gerade die Erscheinungen der Ungezogenheit, Unerzogenheit, Verwahrlosung und Verwilderung offenbaren die prinzipielle Abhängigkeit des Menschen von der Erziehung (vgl. LOCH, 94 zit. nach FENGLER/JANSEN, 191).
Erziehung (education) weist zurück auf das lateinische „educere“ und steht für ,hinausführen‘ bzw. ,auf den Weg bringen‘ (vgl. KÖHN, 539). Dies heißt, und so formuliert es auch Moor (280): „Erziehung besteht nur daraus, dass Erzieher und Zögling einen Weg gemeinsam gehen.“ Dieses Begriffsverständnis hat weitreichende Konsequenzen für die Erziehung bzw. den Erziehungsauftrag.
Zum einen wird deutlich, dass von der Vorstellung Abstand genommen werden muss, dass ein Kind eine amorphe Masse, ein Tonklumpen in der Hand des Erziehers ist, aus dem der Erzieher erst einen Jemand schaffen muss (vgl. KOBI, 74). Jedes Kind ist bereits durch seine Geburt eine eigenständige, zu akzeptierende und zu respektierende Persönlichkeit. Es bedarf allerdings auf dem Weg der Entwicklung und der Selbstentfaltung - zu seinem Leben und seiner Form (vgl. NOHL, 134) - die Hilfe und Unterstützung der Eltern bzw. Erzieher.
Zum anderen wird die Interdependenz zwischen Kind und Erzieher deutlich, die - in einem gegenseitigen Wandlungs- und Gestaltungsprozess - an einer gemeinsamen Welt der gegenseitigen Verständigung arbeiten (vgl. KOBI, 75). Erziehung muss also verstanden werden, als
„... ein gegenseitiges befriedigendes ... und die Persönlichkeitsentwicklung förderndes Zusammenleben von Menschen. (...) Den konkret gelebten zwischenmenschlichen Beziehungen kommt hierbei eine hohe Bedeutung zu. Sie s i n d zu einem wesentlichen Teil Erziehung.“ (TAUSCH/TAUSCH, 28; Hervorhebungen im Text)
Wie diese zwischenmenschliche Beziehung - das pädagogische Verhältnis (vgl. NOHL, 134) - gestaltet sein muss, um wirksam sein zu können, wird eingehend in Kapitel 5.2.3 betrachtet.
3.2 Aufgabe der Erziehung
Die wichtigste Aufgabe der Erziehung ist nach FENGLER/JANSEN (191), Kinder mit Verhaltensmöglichkeiten und Kenntnissen auszustatten, die sie in die Lage versetzen, mit sich selbst und Situationen angemessen umgehen zu können. Erziehung soll die vier Grundwerte menschlichen Zusammenlebens
Selbstbestimmung einer Person,
Читать дальше