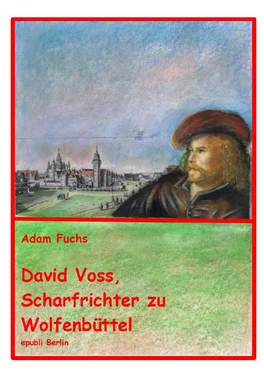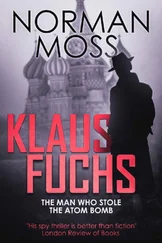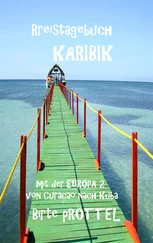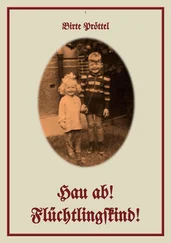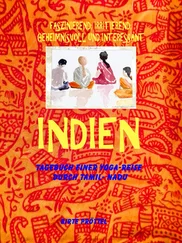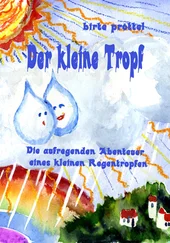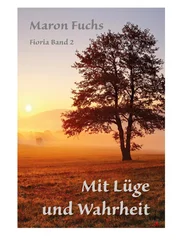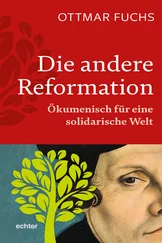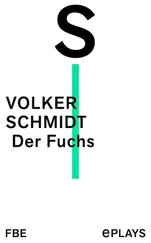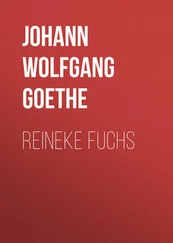1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Es ist natürlich nicht unsere Richtstätte, sondern die des Herzogtums, aber irgendwie fühlte ich mich schon als Hausherr dort oben auf den beiden Hügeln, auf denen die Galgenbäume und die Räder aufgebaut sind.
Mein Vater hatte unter den letzten Bäumen des Lechelnholzes eine Bank aufstellen lassen, um verschnaufen zu können, bevor er sich nach dem langen Weg hügelaufwärts an die Arbeit auf dem Richtplatz machte. Einen wunderbaren Blick hat man von dort und wenn gerade kein Reisender vorbeikam und ich glaubte, ganz allein zu sein, konnte es schon einmal vorkommen, dass ich die Arme ausbreitete und mir einbildete, ich könnte fliegen und wie die Bussarde, die ständig über den Feldern kreisen, hinab in das Tal gleiten.
Auf diese Weise landete ich unten an der Oker und spazierte zu den Resten des schwedischen Dammes, wo ich gelegentlich auf Feist traf, der gern im hohen Gras unter den kleinen Birken, die inzwischen aus dem Bauwerk wuchsen, vor sich hinträumte.
Er ging oft dorthin, weil man so schön in der Sonne liegen und ziemlich sicher sein konnte, dass niemand vorbeikam, da der Damm zu weit vom Dorf entfernt lag.
Auf den Resten des Dammes konnte man noch ganz wunderbar herumklettern und mit einem Schwert in der Hand von hier oben die "Festung Gulfherisbuttele" erstürmen - und natürlich einnehmen.
Die Geschichte von Gulfherisbuttele hatten wir nämlich gerade am Morgen in der Schulstube gehört und sie war so beeindruckend gewesen, dass wir sie sofort am Nachmittag in die Tat umsetzen mussten.
Gulfherisbuttele
Beim Günther lernten wir das Rechnen, Schreiben und Lesen, sein Steckenpferd aber war die Heimatkunde.
Er hatte schon mehrere Heftchen zur Geschichte der Festung verfasst und darüber, wie der schwedische Damm konstruiert worden ist.
Hatten wir keine Lust zum Rechnen (was fast täglich der Fall war), genügte eine beiläufige Bemerkung wie:
"Herr Günther, mein Vater sagt, in der Asse gibt es biblische Bäume", und schon sprudelten aus ihm die Geschichten hervor von Diptams, diesen scheinbar brennenden Dornbüschen, rollenden Feuerrädern der Germanen und so weiter.
Und wenn Feist zum -zigsten Male treuherzig fragte, ob die Festung Wolfenbüttel ihren Namen von den vielen Wölfen in der Gegend erhalten hat, war der alte Herr nicht zu bremsen.
"Nein, mein Junge", fing er dann an. "Ich habe es euch schon mehrfach erklärt, aber du bist zu einfältig, es dir zu merken.
Der Name Wolfenbüttel hat überhaupt nichts mit Wölfen zu tun.“
"Ach schade", pflegte Feist dann zu murmeln und ließ auf diese Weise den Güntherschen Redefluss zu einem breiten Strom anschwellen.
"Der Name Wolfenbüttel", erklärte der mit weit ausholenden Gesten, "hat sich eingeschliffen aus viel älteren Wörtern.
Auf alten Karten seht ihr manchmal das Wort „Wulvenbuttel“ oder „Wulferisbuttele“ oder sogar „Gulfherisbuttele“.
Und zu der Entstehung des Namens Gulfherisbuttele gibt es eine wunderbare Sage, aber die will ich euch heute nicht erzählen, weil wir jetzt endlich mit den Rechenaufgaben fortfahren wollen.“
"Herr Günther, mein Vater sagt, dass es ein Herr Gulfher war, der die Burg gebaut hat und von dem sie den Namen hat!"
Das war die piepsige Stimme von Rheyn, dem Streber.
Aber heute durfte das mal durchgehen, denn auf der Stelle hatte Herr Günther die elenden Rechenaufgaben vergessen und legte Klein-Rheyn väterlich die Hand auf den Kopf.
"Nun ja, mein Junge, da ist schon etwas dran.
Deinen Vater habe ich ja auch schon unterrichtet, da wird er die Geschichte wohl noch in Erinnerung haben.“
"Ja", piepste artig der Rothaarige." „Mein Vater sagt, das ist eine ganz ganz alte Geschichte.“
"Sicher, sicher, das ist wohl wahr. Sie stammt noch aus der Zeit, als es hier, wo wir heute wohnen und auch dort, wo heute die Festung steht, nichts gab als Wald, Wald und nochmals Wald.
Wald, so weit das Auge reichte. Und Sumpf. Tiefen, undurchdringlichen Sumpf. Und mitten im Sumpf den Fluss.
In diesem riesigen Wald wohnten die Germanen, unsere Vorfahren.
An vielen Stellen im großen Sumpf gab es noch von den alten Gletschern zurückgelassene Sandhaufen.
Gletscher sind große, große Flüsse aus Eis und die Sandhaufen, die sie beim Abschmelzen zurückgelassen haben, die nennt man eine Geest.“
Flüsse aus Eis! Wer das wohl glauben mag. Aber Herr Günther erzählte schon weiter:
„Auf diesen Geesten ließen sich die Germanen nieder, fällten die Bäume ringsum und bauten sich Häuser daraus.
Immer eine große Familie lebte in einer solchen Niederlassung. Mehrere Familien gehörten zu einem Stamm und die Stämme waren zusammengefasst in Gauen. Hier in unserer Gegend, damals genannt der Darlingau, lebte der Stamm der Cherusker.
Die Cherusker sind später berühmt geworden durch Armin, der die Römer geschlagen hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die Cherusker waren ein eher kleiner Stamm und hatten sich an der Weser, in der Heide und bis an den Harzrand angesiedelt.
Sie suchten sich zum Siedeln gern Stellen, an denen man nicht nur trocken wohnen, sondern auch bequem durch den Fluss steigen konnte, weil er durch die Sandaufschüttungen flach war.
Eine solche Stelle nennt man eine Furt.
So kam es zur Ansiedlung eines cheruskischen Dorfes dicht am Fluss Ovaccra, wie sie unsere Oker nannten, auf dem östlichen Geestrücken, der aus dem Morast herausragte.
Die Bewohner gelangten durch die Furt in Richtung Westen zur Weser und weiter bis an den Rhein, wo auf der anderen Seite die Römer das Land besetzt hatten, mit denen sie regen Handel trieben.
Die Römer verkauften ihnen Silber und Glaswaren, die Cherusker lieferten Tierfelle und Welpen von germanischen Bärenhunden, die die römischen Soldaten für ihre Feldzüge als Kampftiere brauchten.
Mit der Zeit entstand auf der östlichen Geest eine bedeutende Ansiedlung, die für germanische Verhältnisse recht gut befestigt war.
Für römische Verhältnisse waren diese aus Baumstämmen gebauten Hütten mit ihren geschichteten Kalksteinmauern drumherum ein Scherz und sie nannten die Anwesen spöttisch "castrum", was auf Deutsch "Lager" oder auch „Burg“ bedeutet und bei den Römern große, aus Stein gebaute Befestigungen waren.
Die Germanen freuten sich über diese Bezeichnung und übernahmen das Wort. Dazu setzten sie ihre alte Bezeichnung für Stein, nämlich "Lech", und schon war der schönste Dorfname in feinstem Latein-Cheruskisch entstanden:
Castrum lechidi, die besteinte Burg, woraus später Lechidi, Lechede, Lecheln und Lechlum wurde.
Den Fluss unten durch den Sumpf nannten sie Ovaccra, woraus der Name Oker entstand. Die Ansiedlung castrum lechidi oder Lechlum wuchs und wuchs und wurde reich und immer reicher.
Irgendwann aber war die Zeit der alten Römer und der alten Germanen vorbei und es kam die Zeit der Christen. Und mit den Christen kamen die Karls in unsere Gegend.
Erst Karl Martell, genannt der Hammer, und das nicht etwa, weil er ein so guter Zimmermann war.
Und dann der Große, was nichts mit seiner Kleidergröße zu tun hatte.
Die Beiden fielen nacheinander über die hier lebenden Stämme her und bekehrten mit dem Schwert in der Hand die von ihnen so genannten Heiden zum Christentum. Jedenfalls behaupteten sie das.
In Wahrheit dürften sie es eher auf die Handelswege und die reichen Ansiedlungen hier abgesehen haben.
Tja, das Christentum.
Das war schon was mit den Karls und ihrem Christentum. Wer nicht freiwillig oder fix genug zum neuen Glauben übertrat, der wurde mit dem Schwert überzeugt. Viele viele Tote hat es gegeben, bis die Menschen endlich verstanden hatten, dass es mit dem Heidentum vorbei ist und ihre alten Götter nichts mehr taugten und sie jetzt einen neuen, viel besseren Gott hatten.
Читать дальше