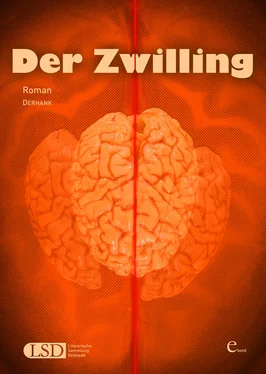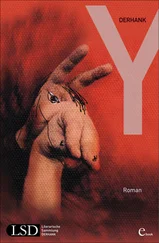1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 Und noch zwei: Ein Mann und eine Frau, von denen du sofort weißt, dass das Leons Eltern sind. Ein Blick genügt. Zwei im besten Alter, wie man sagt, eher in den Sechzigern als in den Siebzigern und doch auf diese bestimmte Art gealtert, wie manche Leute automatisch altern, wenn ihre Kinder aus dem Haus sind. Er groß, einst gewiss kräftig und jetzt einen Bauch angesetzt, aber letztlich ganz normal, mit seinem fast weißen Resthaar, mit seiner dank Mutters Küche rosigen Haut und dem tadellos sitzenden Anzug. Fast schon zu tadellos. 'Mutters Küche' ist genau das, was die Frau an seiner Seite ausstrahlt. Sie ist schmaler als er, aber nicht schmächtig, ihre Frisur wie aus der Werbung, doch ihr Gesicht weiß und von einem plötzlichen Altersschub zerfurcht. Ein Sorgengesicht, sie sieht dich an wie eine, die dich geboren und mit Inbrunst großgezogen hat. Und beinahe vergebens und dass das hier jetzt ein Wunder ist.
Ihr schweigt. Dir scheint, man hat sie, deine Eltern, eindringlich davor gewarnt, dich zu überfallen. Ihr schweigt eine Weile, nur Sylvie hält deine Hand, bis sie zögerlich zu reden beginnt, wie einen Faden aufnimmt und wie für deine Eltern spricht, und dass die Firma laufe, es wäre alles gut und man müsse sich keine Sorgen machen und dann doch diese fremde Mutter, deine, die »mein Junge« sagt und zu dir kommt und auch ein Stück Hand abhaben möchte. Dann steht auch der Vater über dir, herrisch und unsicher zugleich, und stellt resolut und nichtssagend fest, dass »das ja noch mal gut gegangen« sei, und die »Investition sich gelohnt« habe. Sich gerade »auszahlt«. Nur am Rande bemerkst du, dass auch dein Sohn nun direkt am Bett steht. Dein Sohn. DEIN. Es ist zum Irrewerden.
Dein Schweigen, deine Passivität, deine offensichtliche Teilnahmslosigkeit ist allen unheimlich und nur bedingt durch deinen Zustand zu erklären, sie scheinen zu ahnen, dass an dir mehr anders ist als das, was erwartet anders hätte sein müssen.
Zwing dich, Thomas, Thomas in Leon, zwing dich, Leon zu sein!
Du ziehst deine Hand aus dem Händewirrwarr zurück, hebst den Arm, soweit die Ellenbogenmullbinde das zulässt, streckst ihn mechanisch nach Sylvie aus, die einzige hier, die dir wenigstens ein winziges bisschen vertraut ist, du berührst eine Haarlocke, die sich aber deinen ungeschickten Fingern entwindet, worauf sie deine Hand erneut aufgreift, geradezu dankbar für deine Geste, und du ein Gesicht zu machen versuchst, ein freundliches, hoffendes, aufmunterndes, was bei ihr aber nur Stirnrunzeln auslöst. Wie mag Leons Blick gewesen sein, wenn er versucht hat, sie so anzuschauen? Wie hat das ausgesehen? Du weißt es nicht, natürlich nicht.
Beim Abendessen - Eltern und Sohn sind gegangen - hilft sie dir. Graubrot, das sie mit Schmierkäse bestreicht und dessen Rand sie abschneidet, und Krankenhaustee aus einer Schnabeltasse. Häppchenweise, schluckweise. Obwohl du dich wieder in die Mundhöhle verkrochen hast, schmeckst du nichts. Gar nichts, die eingespeichelten Klumpen umspülen dich, selbst die Zunge hat kaum Kraft, sie in die Speiseröhre zu schieben, wo sie fast von alleine hinunterrutschen, du hörst Magengeräusche und bleibst ohne Kontakt zu deiner unteren Körperhälfte. Das Glucksen deiner Eingeweide ist euch eher peinlich, als dass es Heiterkeit auslöst.
Du musst noch einmal auf die Toilette, ja, diesmal die Toilette, Windel und Pfanne willst du dir ersparen, und so bittest du Sylvie und die das Geschirr abräumende Krankenschwester, dir zu helfen.
Ein Fortschritt sei das, so die Schwester, und je eher, desto besser. Sie löst die zahllosen Verbindungen zu den Geräten, nur der Helm bleibt, und dann hilft sie dir, dich aufzurichten. Sie wartet geduldig, bis der Schwindel vorübergeht, lange fremde nackte Beine baumeln von der Bettkante, Pantoffeln, die Sylvie über krallige Füße schieben will, aber du schüttelst sie ab, du willst den Boden unter dir spüren, und dann stehst du auf.
Sylvie und die Schwester stützen dich von links und von rechts, führen dich mit schlurfenden, kaum fühlbaren Schritten zur Nasszelle, neben der sich an einem Schrankspind ein hoher Garderobenspiegel befindet und in den du nur zufällig schaust, und dann doch: ein Spiegel, in dem du das erblickst, was vor Millionen Jahren ein Affe auf einer stillen Wasserfläche erstmalig erblickt haben mag: einen ihn anschauenden unheimlichen Fremden, der selbst zu sein ihm unmöglich erscheint.
Ihr müsst anhalten, der Körper hebt und senkt sich vor Anstrengung und mit jedem Atemzug, der Körper, wer ist das? Dieser große Mann dort, dieser Mann mit seiner hohen und zugleich breiten, von seinem Helm halb verdeckten Stirn, darunter ein Haaransatz viel zu weit hinten, und unter der randlosen Brille Augen wie von einem Vogel, nie so fremde Augen geschaut, und die Nase ist ein fleischiger Schnabel, dominant über einem kleinen, in dieses flächige Gesicht wie mit einem Haarpinsel hineingezeichneten beinahe malerisch gekräuselten Mund. Dieser Mann in seinem weißen erbärmlichen Nachtkittel, dessen lange Arme auf den Schultern zweier Frauen ruhen, und dessen Füße wuchernde Karikaturen von horngelb bekrallten Riesenfüßen sind, dieser Mann im Spiegel sagt unkontrolliert: »Das - bin - ich - nicht!«
Das ruft, stöhnt dieser Riesenvogel im Spiegel da und zugleich rufe ich und stöhne ich selbst, und die Vogelaugen treten hervor und die Schnabelnase bebt und die schmalen Lippen zittern und öffnen sich und ich sehe die für dieses große Gesicht viel zu kleinen Vogelzähne und ich wähne mich wieder hinter sie zurück, zurück in die Mundhöhle, die ich von innen schließen will, ich will mich hinein- und hinabstürzen und mich von innen verdauen lassen, auflösen, will weg sein, weg! Und dann schaue ich doch wieder hin, in den Spiegel, ins Gesicht des Vogels, das von Schnitt- und Schürfwunden an Wangen und Nase übersät ist, und die gesamte linke Gesichtshälfte umspannt ein Bluterguss, der ihm zusätzlich etwas Archaisches gibt, aber mein Entsetzen ist nicht deswegen, nicht wegen der Wunden, und auch nicht wegen der Krone, die der Mann trägt, ein Helm, unter dem Hunderte von miteinander verdrahteten elektrischen Sonden in seinem geschorenen Schädel stecken, und an dessen Rändern sich nie gehabtes blondes Haar herauswindet, eine Helmkrone, deren unzählige feine Kabel in einem auf seiner Schulter liegenden, faustdicken Gerät gebündelt werden und von dort in einem Schlauchrohr mit einer neben dem Bett stehenden Maschine verbunden sind, die aussieht wie eine auf einem komplizierten Geflecht stehende, fast wie schwebende goldene Kugel, und die deinem Denken den Takt gibt. Das ist nur der Hirnschrittmacher, weißt du, auch auf den bist du vorbereitet, ja, den kenne ich, ich kenne das! Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, ein reformatiertes Gehirn wieder in die Ausgangslage Tag X zurückzuprogrammieren, und ich weiß auch, dass man nach einem Unfall anders aussieht, Geschichten von sich nicht wiedererkennen usw. usf. und oft genug gehört, das weiß ich alles, aber der da, der da im Spiegel, der »DAS BIN NICHT ICH!!!« brüllt, der brüllt es an dir vorbei, durch dich hindurch, vergeblich stemmst du dich dagegen, dich so preiszugeben, dich zu offenbaren, Selbstmord ist das!, willst du zurückrufen in den Schlund, aus dem die Worte kamen und die doch meine sind, meine eigenen, ich selbst habe sie gerufen, ein Leon wäre froh gewesen, sich dort im Spiegel wiederzufinden, ich aber finde dort nichts, niemanden, der froh ist, ich schaue in einen Monitor oder was, das ist doch kein Spiegel, dieser komische Vogel ist doch Wahnsinn, das kann nicht wahr sein, dass der da alles nachmacht, was ich mache, jede Bewegung seiner Bewegungen ist ich, das ist doch Wahnsinn, dass der da ich bin!
Ich falle unter den Armen der Frauen in mich zusammen, mein Blick trifft im Spiegel auf den Blick des Sohnes, weißes Gesicht und aufgerissene Augen, dann verschwimmt der Kontakt und etwas lässt mich die Arme heben und dem Mann im Spiegel seine Schwingen hochreißen, das Nachthemd flattert wie ein Federkleid und er will sich die Krone vom Kopf reißen, aber etwas in mir kämpft dagegen an, die Arme kreisen wie Flügel unkontrolliert in der Luft, ich falle, ich falle und weiß nicht, ob ich mich dabei drehe oder die Welt sich um mich herum, und ob das wirklich ein Fallen ist oder ein Schweben, was ja auch nur freier Fall heißt, nein, ich falle!, schreie ich, nein, du schreist nicht, da sind nur die unartikulierten Laute eines zu Tode Stürzenden, eines im Fallen hilflos Strampelnden und Zappelnden, der flatternde Riesenvogel im Spiegel fällt mit seinem aufgebauschten Nachthemd zu einem Knäuel aus Kopfkabeln und Gliedmaßen in sich zusammen, seinen eigenen Gliedmaßen und anderen, die ihn zu entwirren suchen, und mittendrin, plötzlich und aus tiefster Seele erfasst dich eine nie gekannte Wut.
Читать дальше