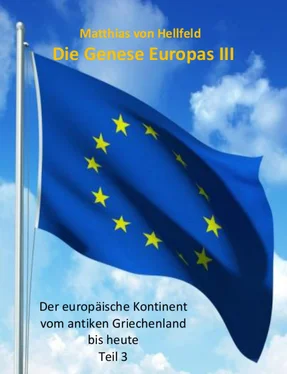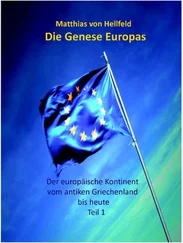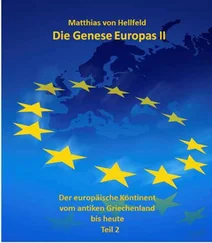Gemeinsam machen sie sich daran, ein Manifest zu schreiben, das im Januar 1848 fertig ist und einen Monat später in London erscheint. Sie nennen ihr Werk „Manifest der kommunistischen Partei“ und versehen es mit dem Slogan „Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“ Wie kaum ein zweites Buch tritt dieses Manifest für die „klassenlose Gesellschaft“ einen weltweiten Siegeszug an. Das „kommunistische Manifest“ zeigt den Geknechteten einen Ausweg aus der Krise, der so logisch und zwingend richtig scheint, dass er gar nicht falsch sein kann. Es wird viele Jahre dauern bis klar wird, dass die Analyse der wirtschaftlichen Situation des industriellen Zeitalters weitgehend zutreffend, die Folgerungen und Prognosen aber ebenso weitgehend falsch sind.
Karl Marx und Friedrich Engels gehen von der These aus, dass die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften die Geschichte von Klassenkämpfen gewesen ist. Da das Wirtschaftsbürgertum, die „Bourgeoisie“, allein die Produktionsmittel besitzt, wird deshalb die bürgerliche Gesellschaft gezwungen sein, als Konsequenz aus diesen einseitigen Besitzverhältnissen ein für sie arbeitendes Proletariat hervor zu bringen. Um selbst zu überleben, werde die Bourgeoisie weiterhin versuchen, diesen Status Quo aufrecht zu erhalten. Immer mehr Reichtum sammele sich deshalb in den Händen weniger an, während der Rest des Volkes in ein besitzloses und verarmtes Proletariat abwandere. Zwangsläufig folge daraus eine Massenverelendung, die zum Zusammenbruch der bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaftsordnung führe. Der Ausweg aus dem dann entstehenden Chaos könne nur darin bestehen, die Produktionsmittel und den durch Arbeit erwirtschafteten „Mehrwert“ gerecht an jene zu verteilen, die die Arbeit bewerkstelligen.
Da sich die Ungerechtigkeiten der bestehenden Verhältnisse in einer zunehmenden Verarmung des Proletariats zeigen werde und die Besitzenden ihre Produktionsmittel nicht freiwillig hergäben, werde sich das geschändete Proletariat eines – nicht allzu fernen - Tages kraftvoll erheben müssen. In dieser „proletarischen Revolution“ werde das Proletariat die Eigentumsrechte an den Produktionsmitteln übernehmen. Damit seien Kapital und Macht in Händen des Proletariats, das anschließend die Klassengegensätze auflösen und eine Gesellschaft der Gleichen gründen werde.
Als einen ersten Schritt auf dem Weg in die von ihnen propagierte proletarische Zukunftsgesellschaft erkennen Karl Marx und Friedrich Engels 1848 die bürgerliche Revolution in Deutschland. Sie rufen deshalb die Arbeiter auf, die deutsche Revolution zu unterstützen. Den Widerspruch, eine Revolution des bürgerlichen Klassenfeindes zu unterstützen, erklären die beiden damit, dass zunächst der sehr viel schlimmere Feind – die „Reaktion“ – beseitigt werden müsse. Der dann folgende Kampf gegen die Bourgeoisie werde der letzte Klassenkampf in der Geschichte der Menschheit sein und die gesellschaftliche Gerechtigkeit bringen. Das Konzept von Karl Marx und Friedrich Engels gilt nicht nur für Deutschland, sondern für alle Länder, in denen die von ihnen beschriebenen Besitzverhältnisse herrschen. Deshalb rufen sie die „Proletarier aller Länder“ auf, sich zu vereinigen und gemeinsam gegen ihre Unterdrücker zu kämpfen. Die Lehre von Karl Marx und Friedrich Engels ist internationalistisch, weil der zukünftige Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit nicht gegen eine Regierung oder ein Land geht, sondern gegen die ökonomischen und sozialen Verhältnisse überall auf der Welt. Damit werden ihre Anhänger einerseits zum Gegner der Besitzenden. Andererseits führt die „internationalistische“ Ausrichtung dazu, dass sie als „vaterlandslose Gesellen“ abgestempelt werden, weil sie nationale Lösungen als nicht ausreichend ablehnen.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist die soziale Lage eines erheblichen Teils der Deutschen derart miserabel, dass sie den Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels zunehmend Glauben schenken. Den Sinn einer nationalen Gemeinsamkeit mit denen, die sie ausbeuten, können sie auch nicht erkennen. Da der Traum des auf Fairness und Gleichberechtigung beruhenden Verfassungsstaates durch das Scheitern der Revolution von 1848 endgültig geplatzt ist, sind für sie alle Hoffnungen auf eine bessere Zukunft dahin. Und es kommt noch schlimmer. Denn als Antwort auf die gescheiterte Revolution machen die Regierungen des Deutschen Bundes einen verfassungsrechtlichen Salto rückwärts. Im Sommer 1851 werden die Grund- und Menschenrechte, die erst Ende 1848 von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossen worden sind, wieder aufgehoben. Die liberalen Verfassungen einiger Bundesländer werden ebenso einer staatsstreichartigen Revision unterzogen, wie die Presse- und Versammlungsfreiheit im Deutschen Bund kassiert wird. Deutschland ist offensichtlich wieder dort angelangt, wo es nach der Befreiung von französischer Vorherrschaft schon einmal war – in der Lethargie von Biedermeier und Restauration.
Es scheint ein Widerspruch zu sein: Während sich – vergleichbar mit dem Pendelschlag einer Uhr – die politischen Verhältnisse nach den revolutionären Jahren wieder zurück bewegen, erleben die Menschen einen Schwindel erregenden ökonomischen Wandel. Überall entstehen Fabriken, Hütten und Gruben, die auf neue Produktionsmittel setzen und Arbeitsplätze schaffen. Wie ein Spinnennetz breitet sich die Eisenbahn über Deutschland aus und bringt nicht nur die Menschen aus verschiedenen Orten schneller zueinander, sondern befördert auch ein Wirtschaftswachstum, das den Konjunktureinbruch der 40er Jahre vergessen lässt. Die Lebensumstände der Arbeiter bleiben dennoch trostlos. Sie verbringen ihre besten Jahre in eintönigen, lärmenden Maschinenhallen und haben nichts als ihre Haut, die sie zu Markte tragen können. Viele von ihnen resignieren und verlassen das Land. Mehr als eine Million Deutsche wandert zwischen 1850 und 1860 nach Amerika aus, wo sie auf eine Teilhabe an dem ungeheuren Wirtschaftsboom des jungen Landes hoffen. Die Einwanderer aus Deutschland haben rasch einen erheblichen Anteil am Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika, müssen aber auch die Kehrseite der Medaille schlucken: Den Sezessionskrieg, der zwischen 1861 und 1865 in der neuen Welt tobt und mehr als 600.000 Tote fordert.
Der Massenexodus hinterlässt in Deutschland eine erhebliche Lücke in der Arbeiterschaft, gleichzeitig reduziert die Abwanderung aber die Zahl der Hungermäuler, die die industrialisierte Gesellschaft Tag für Tag ausspuckt und nicht ernähren kann. Die Menschen müssen der Arbeit folgen, am Ort ihrer Geburt finden sie meist keine Beschäftigung. Die industrielle Revolution fordert Mobilität, die die Eisenbahn gewährleistet. Ländliche Handwerker ziehen in die schnell wachsenden Städte, städtische Unternehmer siedeln sich in den Industriemetropolen an und ein immer größer werdender staatlicher Verwaltungsapparat zieht ein neu entstehendes Heer von Beamten nach sich.
Der rasante Wandel und die massenhafte Mobilität machen das Leben unsicher und vermitteln ein Gefühl dauernder Bedrängnis durch Neuerungen, die diesen Kreislauf noch beschleunigen. Der Trostlosigkeit ihrer Arbeit folgt ein Zusammenbruch aller sozialen Systeme, in denen sie bis dahin gelebt haben. Gleichzeitig merken die Menschen aber auch, dass das Deutschland größer ist als die von ihnen überschaubare Region. Sie erfahren, dass der ostelbische Junker, der sich in rheinischen Verwaltungsstuben als Landrat versucht, ebenso Deutscher ist, wie der katholische Westfale, der im protestantischen Preußen arbeitet. Die Beschleunigung des Lebens führt nicht nur zum Zusammenbruch der alten Werte, sondern auch zu einem neuen nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl.
Конец ознакомительного фрагмента.
Читать дальше