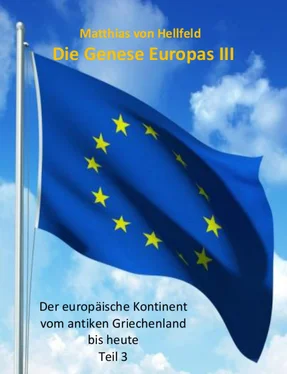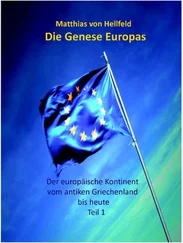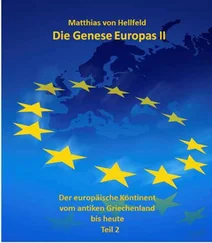Portugal wird seit dem 17. Jahrhundert absolutistisch regiert. Die portugiesische Ständeversammlung – die Cortes - ist zum letzten Mal 1669 einberufen worden und die Weigerung sich an der Kontinentalsperre Frankreichs gegen England zu beteiligen, bewirkt 1808 die Besetzung durch französische Truppen. Nach den Vorbildern im benachbarten Spanien revoltieren portugiesische Liberale gegen die politischen Verhältnisse. Im Sommer 1820 beginnt der Aufstand einige Offiziere in Porto, wodurch die „liberale Revolution“ ausgelöst wird. Ein Jahr später wähnen sich die Revolutionäre am Ziel, denn 1821 wird die erste Verfassung für das Land verabschiedet. Portugal ist nun eine konstitutionelle Monarchie, in der sowohl die Inquisition, als auch die Feudalherrschaft und die Vorrechte der katholischen Kirche abgeschafft sind. Widerwillig kommt König Johann VI. (1767 – 1826) aus Brasilien, der Kolonie Portugals, zurück und akzeptiert die veränderte politische Lage.
In England ist das victorianische Zeitalter angebrochen – benannt nach der langen Regierungszeit von Königin Victoria (1819 – 1901). Das Vereinigte Königreich befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines weltweiten Einflusses. Die an das Parlament gebunden Krone ist bei den Untertanen akzeptiert und beliebt. Victoria ist die erste englische Monarchin, die auch Kaiserin von Indien ist. Die industrielle Revolution, die in England ihren Anfang nimmt, sorgt für eine wachsende Wirtschaft. Das und das hohe Ansehen der Königin haben – vermutlich – revolutionäre Strömungen auf den britischen Inseln verhindern können.
In Griechenland beginnt am 25. März 1821 die erste erfolgreiche Revolution gegen das restaurative Herrschaftssystem des Osmanischen Reichs. Obwohl es anfänglich militärische Niederlagen gibt, gelingt es den Revolutionären zahlreiche Inseln einzunehmen. Der entscheidende Schlag aber ist im April 1821 die Einnahme Athens. Ein Jahr später wird eine erste Verfassung Griechenlands verabschiedet. Als Ägypten auf Seite der Osmanen in den Konflikt eingreift, scheint die griechische Revolution verloren, aber England, Russland und Frankreich stützten die griechischen Aufständischen. In der Schlacht von Navarino kann eine englisch-russisch-französische Armee am 20. Oktober 1827 die griechische Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich sicherstellen. Im September 1831 wird mit dem bayrischen Prinzen Otto (1815 – 1867) ein neuer König gewählt. Griechenland wird eine konstitutionelle Monarchie, die bis zum Militärputsch 1974 erhalten bleibt.
Auch in Italien finden nationale Befreiungskämpfe statt, die aber von Österreich niedergeschlagen werden. Der massive Einsatz des Militärs und die zeitweilige Besetzung der Halbinsel führen dazu, dass die alte, restaurative Ordnung wieder eingesetzt wird. Der Sieg der Revolution ist – fürs erste jedenfalls – verhindert. Nach dem österreichischen Sieg in Italien ist Europa am Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Ausnahme Griechenlands fest in der Hand der Restauration – garantiert von Russland, Österreich und Preußen.
Dramatischer sind die Vorgänge in Frankreich, wo seit 1824 der Bourbonenkönig Karl X. (1757 – 1836) regiert. Ein Jahr vor seinem Regierungsantritt haben französische Truppen den Aufstand in Spanien niedergeworfen und König Ferdinand VII. von Spanien wieder zur Macht verholfen. Den Anhängern einer europäischen Revolution ist mit dieser Niederlage ein heftiger Dämpfer versetzt worden. Diese Situation nutzt Karl X. aus, in dem er in Frankreich die Pressefreiheit einschränkt und drakonische Strafen für eher lächerliche Vergehen verkündet. Das bringt ihm den Ärger seiner Untertanen ein, die der liberalen Opposition bei den Wahlen 1828 die Mehrheit in der Zweiten Kammer verschaffen. Zwei Jahre später wird die Opposition so stark, dass sich Karl X. als Gegenmaßnahme zu einem Staatstreich verleiten lässt.
Nachdem über 200 Abgeordnete dem König das Recht zur Ministerernennung streitig gemacht haben, kommt es zum Eklat: Karl X. löst am 25. Juli 1830 die zweite Kammer auf, schränkt das Wahlrecht ein, verschärft die Pressezensur und verringert die Zahl der Abgeordneten. Das französische Volk ist damit fast wieder in der Situation, unter der es vor Beginn der französischen Revolution 1789 zu leiden gehabt hat. Die „Juli-Revolution“, die daraufhin 48 Stunden später in Paris ausbricht, dauert drei Tage, bevor sie siegreich zu Ende geht. Am 29. Juli 1830 ist das Königtum der Bourbonen zusammen gebrochen, das Militär ebenso aus der Stadt vertrieben wie der König. Die französische Republik ist gerettet.
Die bürgerliche Mehrheit der Zweiten Kammer trägt daraufhin Louis Philippe (1773 – 1850), dem Herzog von Orléans, unter der Bedingung die französische Krone an, dass er die Errungenschaften der französischen Revolution akzeptiert. Die Trikolore wird wieder die französische Nationalflagge und die „Marseillaise“ die Nationalhymne. Louis Philippe ist der erste französische König, der die Krone aus den Händen des bürgerlich-liberalen Parlaments erhält. Damit ist Frankreich eine konstitutionelle Monarchie, in der König und Parlament nach Recht und Gesetz die Geschicke des Volkes lenken. Die Inthronisierung dieses „Bürgerkönigs“ markiert gleichzeitig auch das Scheitern der europäischen Nachkriegsordnung. Der König wird durch das Parlament berufen und kann sich nicht mehr auf irgendein „legitimes“ Erbfolgerecht seiner Familie berufen. Damit ist einer der Grundsteine zerstört, auf denen die Garantiemächte des Wiener Kongresses 1815 die europäische Nachkriegsordnung aufgebaut haben.
Nation Building in Europa
Die Niederlande bekommen 1813 mit der Krönung von König Wilhelm I. (1772 – 1843) ihre Unabhängigkeit. Vorher ist das Land von den Truppen Napoleons besetzt gewesen. Beim Wiener Kongress wird den Niederlanden noch das Gebiet des heutigen Belgiens hinzugefügt. Die niederländische Verfassung von 1848 ist für das Land ein Meilenstein, denn mit der Einführung der Ministerverantwortung ist der Weg zu einer demokratisch verfassten konstitutionellen Monarchie vorgezeichnet.
Auch Italien bleibt von den revolutionären Erhebungen nicht unberührt. Die ersten nationalen Aufstände sind aber deshalb nicht erfolgreich, weil sich die Revolutionäre nicht auf ein gemeinsames Ziel und eine von allen vertretene Strategie verständigen können. Die italienischen Revolutionäre müssen sich zunächst der Übermacht des österreichischen Militärs geschlagen geben. Die nationale Befreiung Italiens wird erst 1870 erfolgreich sein, aber die Ideen von Giuseppe Mazzini (1805 – 1872) und Giuseppe Garibaldi (1807 – 1882), die für die nationale Selbstbestimmung aller Völker kämpfen, hinterlassen ihre Spuren.
Auch polnische Nationalisten versuchen sich von der Fremdbestimmung durch die Politik des russischen Zaren Nikolaus I. zu befreien. Unterstützt vom polnischen Heer wagen Offiziere und Intellektuelle den Aufstand gegen die Besatzer, müssen aber in der Folgezeit militärische Niederlagen hinnehmen. Durch massiven Militäreinsatz kann der russische Zar die Macht im Land erhalten, aber der polnische Aufstand löst überall in Europa und gerade auch in Deutschland große Begeisterung aus. 1846 wird der Plan eines weiteren Aufstands in Polen den russischen Besatzern verraten. Der Aufstand scheitert.
Die Auswirkungen der „Julirevolution“ in Paris sind auch in anderen europäischen Staaten zu spüren. Der Funke springt zunächst nach Belgien über, wo sich die Revolutionäre nach einjährigem Kampf erfolgreich gegen die niederländische Herrschaft durchsetzen. Im Londoner Vertrag vom 15. November 1831 wird Belgien schließlich anerkannt. In der bald darauf erlassenen belgischen Verfassung ist das Volk der Souverän, dessen Volksvertretung – wie in Frankreich – den König wählt. Auch in der Schweiz rühren sich nationale Kräfte und erreichen bis 1848 die Verabschiedung einer neuen Verfassung für die schweizerische Eidgenossenschaft, deren Merkmal die bis heute gültige Referendumsdemokratie ist.
Читать дальше