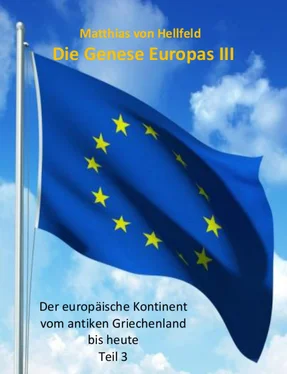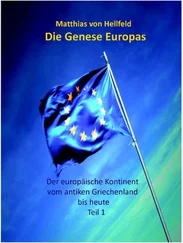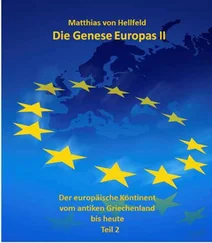Deutsche Nationalisten verfolgen die Vorgänge in Europa aufmerksam, aber eine ähnliche Revolte wie bei den Nachbarn gibt es in Deutschland nicht. Dennoch ist der Wunsch nach Veränderungen auch hier unübersehbar. Am 7. September 1830 stürmen Braunschweiger Bürger das Stadtschloss, ähnliches geschieht in Kassel, in Sachsen, in Hannover und in Göttingen, wo im Januar 1831 Studenten und einige Bürger unter Führung von drei Universitätsdozenten die Stadt für einige Tage unter ihrer Kontrolle haben. Wenig später bereiten 7.000 Soldaten aus Hannover dem Aufstand in Göttingen ein Ende. Noch drastischer wird es 1837, als Ernst-August (1771 – 1851), Herzog von Braunschweig-Lüneburg, den Königsthron in Hannover besteigt. Zeitgenossen beschreiben den neuen König von Hannover als jemanden, der schon alle „menschlichen Verbrechen“ außer dem Selbstmord begangen habe und genauso regiert er das Land auch. Er setzt die liberale Verfassung außer Kraft, was den Widerspruch von sieben angesehenen Göttinger Hochschullehrern provoziert. Sie bestehen auf der Gültigkeit der Verfassung von 1833. Aber König Ernst – August bleibt hart und schmeißt sie aus dem Land. Die „Göttinger Sieben“ erhalten überall in Deutschland Zuspruch, weil sie dem Wunsch vieler Menschen nach einem geeinten Staatswesen, das auf einer Verfassung mit Rechtssicherheit basiert, durch ihr mutiges Eintreten gegen die königliche Willkür Ausdruck verliehen haben.
Aber die Bekundungen des deutschen Einheitswillens münden in keine Bewegung, die von allen Deutschen getragen wird. Dennoch wächst die Zahl der Anhänger einer deutschen Einheitsbewegung. Sichtbarer Ausdruck ihrer Existenz ist ein Fest, das vom 27. bis zum 30. Mai 1832 vor den Toren des Hambacher Schlosses in der Pfalz stattfindet. Mehrere zehntausend Menschen sind zusammen gekommen, um für einen bundesstaatlichen Zusammenschluss Deutschlands zu demonstrieren. Das Fest wird beherrscht von schwarz-rot-goldenen Fahnen, deren Farbkombination an die Uniformen des Freikorps Lützow während der Befreiungskriege gegen Napoleon I. erinnert. Daran knüpfen die Teilnehmer des Hambacher Festes an und deklarieren die Farben des Freikorps zu den „deutschen“ Farben. Sie demonstrieren für die Einheit und Freiheit Deutschlands und für eine föderative deutsche Republik, die gleichberechtigter Partner in einem europäischen Staatenbund sein soll. Den Ruf nach einer Abkehr von der reaktionären „Heiligen Allianz“ kleidet der Schriftsteller Johann Wirth (1798 – 1848) in eine Klage über die „knechtische“ Haltung der Deutschen gegenüber den Unterdrückern der nationalen Freiheit des eigenen Landes:
„Die Regungen der Vaterlandsliebe sind uns unbekannt, was dem Vaterland Not tut, ist Hochverrat. (…) Wir helfen Griechenland befreien, wir trinken auf Polens Wiederauferstehung, wir zürnen, wenn der Despotismus der Könige den Schwung der Völker in Spanien, in Italien lähmt, (…) wir beneiden den Nordamerikaner und sein glückliches Los, das er sich mutvoll selbst erschaffen: Aber knechtisch beugen wir den Nacken unter das Joch der eigenen Dränger (…) Es wird kommen der Tag (…), wo ein selbst gewobenes Bruderband alle umschließt zu politischer Einheit und Kraft; wo die deutsche Flagge, statt Tribut an Barbaren zu bringen, die Erzeugnisse unseres Gewerbefleißes in fremde Weltteile geleitet und nicht mehr unschuldige Patrioten für das Henkerbeil auffängt, sondern allen freien Völkern den Bruderkuss bringt.“
Der romantisierende Nationalismus, von dem Johann Wirth und seine Zuhörer in Hambach schwärmen, verhallt in Deutschland zwar noch weitgehend ungehört, ist aber heute eine der demokratischen Traditionen der Bundesrepublik Deutschland.
In Deutschland breitet sich zu Beginn der 30er Jahre Armut aus. Im Vergleich zu England, wo seit Anfang des Jahrhunderts die Industrialisierung einen ökonomischen Aufschwung bewirkt hat, sind die Länder des Deutschen Bundes unterentwickelt. Bis 1840 wandern knapp 200.000 Menschen aus, zehn Jahre später ist es fast eine halbe Million. Not und Armut sind so groß, dass zahlreiche Städte dazu übergehen, Armutswanderer mit strengen Vorschriften von ihrem Gebiet fernzuhalten. Das Problem der Massenarmut wird aufs Land verschoben und lässt dort die Frage aufkommen, ob ein geeinter Nationalstaat nicht viel besser mit Landstreicherei und Armut zu Recht kommen würde. Gleichzeitig glauben viele, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung nicht nur die materiellen Probleme lösen, sondern auch den gemeinsamen deutschen Staat würde schaffen können. Dabei sind industrielle Fertigung durch den Einsatz moderner Maschinen und Verbindung der einzelnen deutschen Staaten durch die Eisenbahn die Zauberworte, die eine glückliche Zukunft verheißen.
Voraussetzung dafür ist der 1834 geschaffene Deutsche Zollverein, dem am Anfang neben Preußen die Königreiche Bayern und Sachsen sowie Darmstadt, Hessen und Thüringen angehören. Die Attraktivität eines gemeinsamen Wirtschaftsraums sorgt dafür, dass bis 1866 das Königreich Hannover und das Herzogtum Nassau sowie die Grafschaften Oldenburg und Baden beitreten. Bald danach folgen die norddeutschen Herzogtümer Schleswig, Holstein und Mecklenburg-Schwerin. Während die Ökonomen kühl kalkulierend vor allem die wirtschaftlichen Vorteile für den Transport von Waren und Personen sehen, erkennen die nationalen Revolutionäre im Deutschen Zollverein den Vorläufer eines deutschen Staates. Und tatsächlich entwickelt der Deutsche Zollverein eine beträchtliche politische Schubkraft. Aber trotz Zollverein und großen Anstrengungen bleibt die Industrieproduktion hinter den Bedürfnissen zurück. Die Verwendung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen kommt nur schleppend voran, was besonders in der deutschen Stoffindustrie, die sich der starken englischen Konkurrenz zu erwehren hat, zu Verwerfungen führt. Englische Großhändler greifen auf billige Importe aus den Kolonien zurück und können so die deutschen Händler unterbieten. Die Antwort der deutschen Großhändler ist eine gnadenlose Senkung der Einkaufspreise.
Weberaufstand in Schlesien
Bei den Webern in Schlesien führt das zu chaotischen Zuständen. Trotz harter Akkordarbeit ist der Lohn für die Weber derart niedrig, dass sie nicht mehr überleben können. Unterernährung, hohe Kindersterblichkeit und unbändiger Zorn auf die Zustände, in denen sie leben müssen, sind die Folgen. Am 3. Juni 1844 entlädt sich die Wut der Weber in der schlesischen Kleinstadt Peterswaldau: Sie stürmen die Fabrik des Großhändlers und legen sie in Schutt und Asche. Die Nachricht vom „Weberaufstand“ verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wenig später sind mehr als 3.500 Weber an der Revolte beteiligt. Obwohl sich ihr Zorn ausschließlich gegen die Geschäftspraktiken der Großhändler richtet und auch nur deren Gebäude zerstört werden, fühlen sich auch die Adligen Schlesiens ihrer Haut nicht mehr sicher. Auf ihren Wunsch werfen eilig herbeigeführte preußische Soldaten den Aufstand blutig nieder. Wahllos schießen sie auf die Demonstranten, elf werden getötet – darunter Frauen und Kinder – viele von ihnen verhaftet.
Der Aufstand der schlesischen Weber, dem wenig später der Dramatiker Gerhard Hauptmann (1862 – 1946) ein literarisches Denkmal setzt, schlägt fehl, die Aufständischen werden vor Gericht gestellt und zu hohen Haft- und Prügelstrafen verurteilt. Der Aufschrei gegen die jämmerliche Situation, in der sich die Arbeiter befinden, ist die erste „proletarische“ Revolution, von denen es in Deutschland und Europa in der Folgezeit noch einige geben wird. 1844 aber reagiert die sächsische Regierung mit harten Strafen und Repressionen. Überall in Deutschland werden einige Tausend Berufsverbote und Landesverweise ausgesprochen. Am Vorabend des Revolutionsjahres 1848 gibt es in Deutschland einerseits zahlreiche nationale „Spinner“ und Phantasten, die das Land verherrlichen und der eigenen Geschichte unkritisch und irrational gegenüberstehen. Andererseits wollen Teile der Nationalbewegung Deutschland politisch befreien und entwerfen zu diesem Zweck zahlreiche programmatische Zukunftskonzepte.
Читать дальше