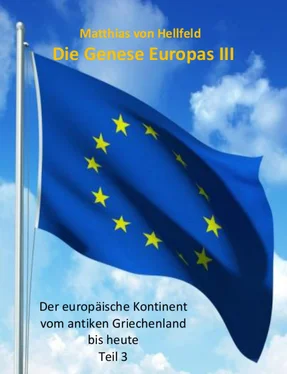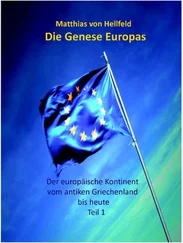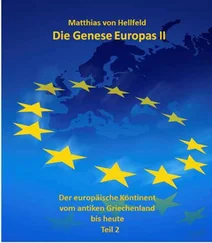Die frustrierte Abordnung der Nationalversammlung reist in der berechtigten Vorahnung nach Frankfurt zurück, dass mit dieser Entscheidung die deutsche Revolution gescheitert ist. Zwei Tage nach ihrer Rückkehr werden die österreichischen Abgeordneten nach Wien zurück beordert, gleichzeitig wird die Reichsverfassung von 28 Kleinstaaten des Deutschen Bundes anerkannt. Aber drei der wichtigsten deutschen Staaten Bayern, Sachsen und Hannover lehnen die Reichsverfassung ab und signalisieren das Scheitern der Bemühungen einen deutschen Zentralstaat zu schaffen. Als sich die Zweite Kammer des preußischen Landtags am 21. April 1849 der Verfassung anschließt, wird sie durch einen königlichen Erlass kurzerhand aufgelöst. Obwohl im ganzen Land die revolutionären Aufstände unter den Knüppeln von Polizei und Militär zusammen gebrochen sind, rufen die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung unbeirrt die Regierungen der Einzelstaaten auf, die Reichsverfassung anzuerkennen. Aber das Ende der deutschen Revolution ist nah.
Am 14. Mai 1849 werden die preußischen Abgeordneten aus Frankfurt abberufen, zwei Wochen später weicht das so genannte Rumpfparlament nach Stuttgart aus. Mitte Juni marschieren preußische Truppen in der Pfalz ein. Dort tagt seit einigen Wochen eine provisorische Revolutionsregierung, deren Truppen von preußischen Soldaten blutig nieder gemacht werden. Am 18. Juni 1849 erringen württembergische Truppen den zweifelhaften Ruf, die letzten Abgeordneten des Stuttgarter Rumpfparlaments auseinander gejagt zu haben. Die verängstigten Männer der Nationalversammlung flüchten in alle Himmelsrichtungen. Den endgültigen Schussstrich unter die gescheiterte deutsche Revolution ziehen am 23. Juli 1849 die letzten in der Festung Rastatt eingeschlossenen Revolutionstruppen: Sie kapitulieren.
Die Revolution von 1848/49 ist zum einen an ihren eigenen Unzulänglichkeiten und an der fehlenden Machtbasis, von der aus sie hätten agieren können, gescheitert. Zum anderen hätte ein großdeutscher Staat das europäische Sicherheitssystem empfindlich gestört, was weder Frankreich noch Russland kommentarlos hingenommen hätten. Einmal mehr müssen die Deutschen zur Kenntnis nehmen, dass ihre Nachbarn ein vitales Interesse daran haben, wie die Mitte des Kontinents politisch gestaltet ist. Eine zersplitterte Mitte Europas sichert den Status Quo der übrigen europäischen Staaten. Eine Machtkonzentration aber birgt aber in den Augen der andren Großmächte die Gefahr einer Destabilisierung Mitteleuropas. Aber die Frankfurter Abgeordneten sind auch an der Frage der Staatsgrenzen gescheitert. Ein Ausschluss Preußens und Österreichs hätte den faden Beigeschmack hinterlassen, einen deutschen Rumpfstaat etabliert zu haben, der – wie der Deutsche Bund - allein nicht überlebensfähig und vom guten Willen der beiden übrigen Deutschländer abhängig gewesen wäre. Die Einbeziehung Preußens und Österreichs hätte zwangsweise die Auflösung der beiden Staaten nach sich gezogen und die Frage aufgebracht, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten in einem Gesamtverband eigentlich hätte aussehen sollen.
Die gescheiterte Revolution von 1848 ist aber nur das eine Problem, das den Europäern und speziell den Deutschen zunehmend Schwierigkeiten bereitet. 1801 brennt im englischen Coalbrookdale der erste mit Koks befeuerte Hochofen. Er wird zum Symbol der beginnenden Industrialisierung und zum Start für flächendeckende soziale Verwerfungen, die den Kontinent über viele Jahre beschäftigen. 1769 hat James Watt (1736 – 1819) die Dampfmaschine erfunden, 1814 ächzt die erste Lokomotive mit einigen Anhängern über die Gleise. Beide Ereignisse sind Symbole für die industrielle Revolution, die in England beginnend rasch auf den Kontinent überschwappt und dort Arbeits- und Familienstrukturen durcheinanderbringt.
In den 40er- und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts steigt die Bevölkerungszahl in Deutschland derart dramatisch an, dass die Ernährung der Menschen mit den herkömmlichen Methoden die Landwirtschaft kaum noch sichergestellt werden kann.
Der einzige Ausweg ist die Intensivierung des Ackerbaus durch den Einsatz von Maschinen. Damit steigt zwar die Produktivität, die Zahl der Landarbeiter aber nimmt ab. Die nun nicht mehr benötigten Landarbeiter flüchten in die Städte, wo sie auf Arbeit in der entstehenden Industrie hoffen. Aber auch in den Städten sind die Folgeprobleme der Industrialisierung unübersehbar, denn die neuen maschinellen Produktionsmöglichkeiten treten in Konkurrenz zu dem bis dahin vorherrschenden Kleingewerbe. Dadurch steigen auch in den Städten die Arbeitslosenzahlen. Es herrscht also bei den Landarbeitern und bei den in den Städten nicht mehr benötigten Arbeitern eine doppelte Arbeitslosigkeit. Das Überangebot an Arbeitskräften führt zu extrem niedrigen Löhnen und Arbeitsbedingungen, die jeder Beschreibung spotten. Nicht zum letzten Mal zahlen die Arbeiter den Preis für den industriellen Fortschritt, von dessen segensreichen Folgen sie allerdings nicht profitieren.
Arbeitsbedingungen in Deutschland
Der Arbeitsalltag wird bestimmt durch den Takt der Maschinen, die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr laufen. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts beträgt die normale Arbeitszeit 14 Stunden. Der Hungerlohn, der dabei am Ende herauskommt, reicht für das Überleben einer Familie nicht. Die meisten Kinder bekommen keine Ausbildung, weil sie arbeiten müssen – nicht selten unter Tage, wo sie wegen ihrer Gewandtheit und geringen Körpergröße bestens eingesetzt werden können. Die „Proletarier“ – wie die Arbeiterschaft nun heißt – haben keinen Besitz, keine soziale Absicherung und keine Altersversorgung. Auf Gedeih und Verderb sind sie ihren Arbeitgebern ausgeliefert, die allerdings keinerlei soziale Vorsorge für sie betreiben. Ihre Hoffnung ruht auf den Kindern, weswegen sie ihre vom lateinischen Wort „proles“ (Kind) Bezeichnung „Proletarier“ bekommen haben. Wer nichts hat als seine Kinder, ist ein „Proletarier, der auf eine möglichst große Kinderschar setzt, die ihn im Alter am Leben halten könnte. Aber das führt zu weiterem Wachstum der Bevölkerung und lässt die Folgen der industriellen Revolution noch drastischer werden.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts lebt mehr als die Hälfte der Deutschen in diesem Teufelskreis unterhalb des Existenzminimums. Das „Lumpenproletariat“, wie die ärmsten von ihnen genannt werden, vegetiert in elenden Slums, Fürsorge kennen sie nicht, ihre Familienstrukturen sind weitgehend zerstört und Alter oder Krankheit bedeuten eine unmittelbare Existenzbedrohung. Mit dem „Vaterland“ und einer irgendwie begründeten „nationalen Identität“ haben sie nichts am Hut. Hunger haben sie, arbeiten wollen sie und ein Leben führen, das ihnen die Würde lässt. Die unübersehbare Diskrepanz zwischen einem ungebremsten wirtschaftlichen Aufschwung und der Massenarmut lässt der industriellen Revolution eine dramatische soziale Verelendung folgen, deren Ausmaß erschreckend ist. Wer sich dagegen zur Wehr setzt, riskiert den Verlust des Arbeitsplatzes, Zusammenschlüsse von Arbeitern sind ebenso streng verboten wie die Verbreitung von revolutionären Parolen. Dennoch lassen sie sich nicht mehr lange unter dem Teppich halten, zumal immer wieder aufrührerische Artikel kursieren, die geeignet sind die revolutionäre Unruhe im Land anzuheizen.
Proletarier aller Länder vereinigt Euch!
Einige dieser Artikel stammen aus der Feder des in London lebenden deutschen Zeitungsredakteurs Karl Marx (1818 – 1883). Er unterstützt die Arbeiter in seiner Heimat in der Hoffnung den Beginn einer europäischen Revolte einzuleiten, an dessen Ende das befreite Proletariat stehen werde. Zu Beginn der 40er Jahre lebt er in Paris. Als 1848 in Deutschland die Revolution beginnt, muss er das Land verlassen. Der preußischen Regierung sind seine Zeitungsartikel ein Dorn im Auge, sie fordern die französischen Behörden auf, Marx unter Druck zu setzen und schließlich des Landes zu verweisen. Nach seiner Ausweisung übersiedelt Karl Marx nach Brüssel, wo er dem zwei Jahre jüngeren Friedrich Engels (1820 – 1895) begegnet. Friedrich Engels, Sohn eines wohlhabenden Textilfabrikanten aus Wuppertal-Barmen, ist kurz vorher dem „Bund der Gerechten“ beigetreten, der in London seinen Sitz hat und später zum „Bund der Kommunisten“ umbenannt wird.
Читать дальше