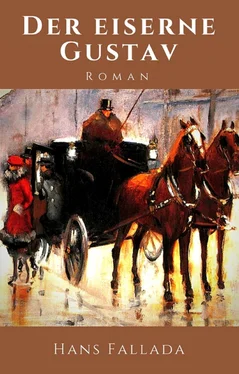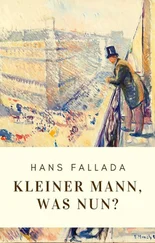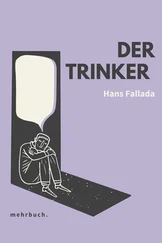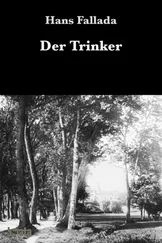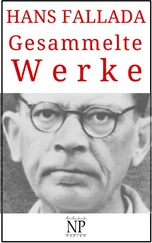Hackendahl wendet sich, will schon gehen, da erst wird ihm klar, daß das zweite Bett in diesem Zimmer unbesetzt ist. Er fragt: „Sophie hat schon wieder Nachtdienst?“
„Sophie? Ja, hat dir denn Mutter nicht gesagt, daß Sophie auch weg ist?!“
„Was heißt weg?!“
„Na, zu ihren frommen Schwestern doch! Sie ist doch heute mittag für ganz ins Krankenhaus gezogen! Mit Sack und Pack. Wir sind ihr ja wohl nicht fromm genug. Wir streiten uns zuviel, hat sie gesagt!“
„So!“ antwortet der Vater bloß. „So! – Na, gute Nacht, Evchen.“
Langsam zieht er die Tür zu, lange steht er auf dem Gang. Schlag auf Schlag, immer schlimmer, zwei Kinder an einem Tage verloren: Und auch Sophie hat mir nicht adieu gesagt! Was habe ich ihnen denn getan, daß sie mich so behandeln?! Nun gut, ich bin streng gewesen, ein Vater muß streng sein! Ich bin vielleicht noch nicht streng genug gewesen! Jetzt sehe ich erst, wie weich sie sind, wie sie gleich ausreißen, wenn es schwierig wird! Die hätten Soldaten sein müssen! Die Zähne zusammen, nicht mit der Wimper gezuckt – und durch!
Er steht da, lange, lange, seine Gedanken gehen hin und her, anklagend, grollend, zornig. Aber so viel er auch bedenkt, er wird nicht weich, er gibt nicht nach! Sie haben ihm schwere Wunden geschlagen, aber er klagt nicht wegen der Wunden, er klagt, daß Kinder eines Vaters Feinde sein können, ihn aus dem Hinterhalte schlagen.
Nein, er gibt nicht nach, der eiserne Gustav strafft den Rücken, er setzt den gewohnten, abendlichen Rundgang fort. Er verkriecht sich nicht in Bett und Wehleid, er geht in das Schlafzimmer der Söhne.
Der Schritt hallt, fahl leuchten die Betten – von dreien sind hier zwei unbesetzt …
„Guten Abend, Vater“, sagt Heinz.
„Guten Abend, Bubi. Schläfst du noch nicht? Es ist schon längst Schlafenszeit.“
„Ich werd schon noch einschlafen, Vater. Du läufst ja auch noch rum und stehst drei Stunden früher auf als ich.“
„Ein alter Mann braucht wenig Schlaf, Bubi.“
„Du bist doch noch kein alter Mann, Vater!“
„Doch!“
„Bestimmt nicht.“
„Doch!“
„Nein.“
Der Vater geht durch das Zimmer, er setzt sich im Halbdunkel auf des Jungen Bett, er fragt ganz kameradschaftlich, gar nicht väterlich: „Hast du ’ne Ahnung, Bubi, wo der Erich hin ist?“
„Keine Ahnung, Vater. Du machst dir wohl Sorgen?“
„Ja; die hier bei uns wissen auch nicht, wohin er ist?“
„Glaub ich nicht. Aber ich kann ja morgen mal in der Penne horchen. Vielleicht weiß einer von seinen Freunden was.“
„Das tu, Bubi.“
„Das tu ich, Vater.“
„Und du könntest mal zum Herrn Direktor gehen. Ich hatte ihm versprochen, den Erich morgen wieder zur Schule zu schicken. Daraus wird ja nun nichts. Du mußt ihm das erklären …“
„Ach, Vater …“
„Was?“
„Ich möchte morgen lieber nicht zum Direx gehen …“
„Warum denn nicht? Du sollst doch nicht Direx sagen!“
„Och – vielleicht hat er ’ne Pieke auf mich. Wir haben uns nämlich heute ein bißchen gekloppt, einer aus meiner Klasse und ich, und Kunze hat uns aufgeschrieben und sagt, er meldet uns dem Direx – dem Direktor.“
„Warum habt ihr euch denn gekloppt?“
„Ach, nur so. Der hat immer so ’ne Schandschnauze, da muß er mal was draufkriegen.“
„Und hat er was draufgekriegt?“
„Aber feste, Vater! Aber nach Noten! Zum Schluß hat er nur noch nach Luft geschnappt und immerzu Pax geschrien.“
„Was heißt denn Pax?“
„Ach, Pax heißt Friede. Das schreit man, wenn man zu Kreuze kriecht.“
„So – na, Bubi, deswegen kannst du dem Direktor ruhig meine Bestellung ausrichten. Der Herr Direktor und ich haben nämlich aus dem Fenster gesehen, wie ihr euch gekloppt habt.“
„Au fein! Ich hatte schon ’nen Bammel, eine Vier im Betragen wäre kummervoll.“
Einen Augenblick ist Stille. Der Vater ist ganz ruhig und friedlich geworden bei diesem Sohn.
„Na, also schön, Bubi, vergiß das nicht. Und schlaf auch gut!“
„Schlaf du auch gut, Vater. Wegen Erich mach dir bloß keine Gedanken. Der ist schlauer als du und ich und der Direktor zusammen – der Erich kommt immer durch.“
„Gute Nacht, Bubi.“
„Gute Nacht, Vater.“
Zweites Kapitel: Ein Krieg bricht aus
Es ist der 31. Juli 1914.
Dicht gedrängt bis tief in den Lustgarten hinein steht seit dem frühen Morgen die Menge am Kaiserlichen Schloß, über dem die gelbe Kaiserstandarte weht, das Zeichen für die Anwesenheit des obersten Kriegsherrn. Unaufhörlich fluten die Menschen ab und zu; sie warten eine Stunde oder zwei, dann gehen sie wieder an ihre täglichen Verrichtungen, die doch nur eilig, nur obenhin erledigt werden, denn auf jedem lastet die Frage: wird Krieg?
Vor drei Tagen hat das verbündete Österreich Serbien den Krieg erklärt – was wird nun geschehen? Wird die Welt ruhig bleiben? Ach, ein Krieg unten auf dem Balkan, ein Riesenreich gegen das kleine Serbenvolk – was kann das schon viel bedeuten? Aber sie sagen ja, Rußland macht mobil, der Franzose rührt sich – und was wird England tun?
Die Luft ist heiß, es wird immer schwüler. Es saust und braust in der Menge. Am Vormittag soll der Kaiser vom Schloß herab gesprochen haben – aber noch lebt Deutschland mit aller Welt in Frieden. Es gärt und braust – ein Monat ist vergangen mit Ungewißheit, mit Hin und Her, unverständlichen Verhandlungen, mit Drohungen und Friedensversicherungen, die Nerven der Menschen sind durch das lange Warten zermürbt. Jede Entscheidung ist besser als dieses schreckliche, dieses ungewisse Warten.
Durch die Menge drängen sich Verkäufer mit Würstchen, Zeitungen, Eis. Aber sie verkaufen nichts, die Leute haben keine Zeit zu essen, sie wollen auch nicht mehr die Nachrichten vom Morgen lesen, die längst überholt, unwahr geworden sind. Sie wollen die Entscheidung! Sie reden abgerissen, erregt miteinander, jeder weiß etwas. Aber dann – mitten im Gespräch – verstummen sie, alles vergessend starren sie zu den Fenstern des Schlosses hinauf. Zu dem Balkon, von dem heute vormittag der Kaiser gesprochen haben soll … Sie versuchen, durch die Scheiben zu spähen, aber die blitzen, blenden in der Sonne; und wo sie hindurchspähen können, sehen sie nur gelbe, matte Vorhänge hängen.
Was geht dort drinnen vor? Was wird in jenem Dämmer beschlossen – über jeden Wartenden, Mann für Mann, Weib für Weib, Kind für Kind? Sie haben vierzig Jahre im Frieden gelebt, sie können es sich nicht vorstellen, was das ist: ein Krieg … Aber doch ahnen sie, daß ein Wort aus dem stummen, verschlossenen Haus dort alles ändern kann, ihr ganzes Leben. Und sie warten auf dieses Wort, sie fürchten es, und sie fürchten doch auch, daß es ausbleiben könnte, daß so viele Wochen Wartens umsonst durchwartet sein könnten …
Plötzlich wird es ganz still in der Menge, als halte sie den Atem an … Es ist nichts geschehen, noch ist nichts geschehen, nur die Turmuhren schlugen, von nah und fern, schnell und langsam, hoch und mit tiefem Brummton: Es ist fünf Uhr …
Noch ist nichts geschehen, sie stehen und warten atemlos …
Da öffnet sich das Tor des Schlosses, sie sehen es aufgehen, langsam, langsam – und heraus tritt: ein Schutzmann, ein Berliner Polizist, in der blauen Uniform, mit Pickelhaube …
Sie starren ihn an …
Er klettert auf eine Treppenbrüstung, er bedeutet ihnen, daß sie still sein sollen.
Aber sie sind ja still …
Der Schutzmann nimmt langsam den Helm ab, hält ihn vor die Brust. Sie verfolgen atemlos jede seiner Bewegungen, obwohl es nur ein ganz gewöhnlicher Schutzmann ist, wie sie ihn alle Tage auf allen Straßen Berlins sehen … Und doch prägt er sich ihnen unauslöschlich ein. – Sie werden in den nächsten Jahren ungeheure und schreckliche Dinge sehen müssen, aber sie werden nie vergessen, wie dieser Berliner Schutzmann seinen Helm abnahm, ihn vor die Brust hielt!
Читать дальше