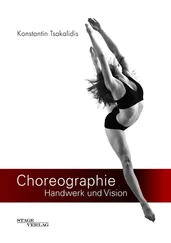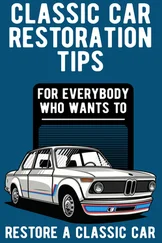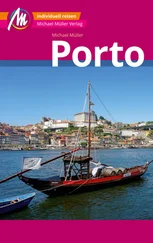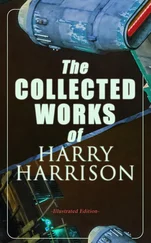»Ja, James was ist denn? Ich bin gerade beim Abendessen.«
»Hi Rosy, ich habe dir einiges zu sagen. Wir müssen uns sofort in der Garage treffen.«
»Weißt du, wie spät es ist? Zudem sagte ich ja schon, ich bin beim Abendessen.«
»Dein Vater ist hier, bei uns. Es geht um Stev, er ist verletzt. Bitte, es ist sehr wichtig... es geht um Leben und Tod!« Ich brach den Anruf ab. Rosy würde kommen, ganz bestimmt.
Mit einem »Bin gleich wieder da«, schnappte ich mir meine Jacke vom Halter neben der Tür zu meinem Zimmer und stürmte an Mina und Simone vorbei. Aus der Bibliothek konnte ich die Stimme meines Vaters hören.
Schnell lief ich über den kleinen geschotterten Weg an unserem Haus vorbei und zum Waldrand, der die Grenze des Grundstücks der Harrisons bildete. Dort stand eine einsame Garage, deren Einfahrt von hohem Gras überwachsen war.
Es war lange her, als wir uns hier, in der zweiten Garage von John, unser Quartier eingerichtet hatten. Er hatte sie damals meinen Freunden und mir bereitgestellt, nachdem wir immer mein, für vier Teenager zu kleines Zimmer belagert hatten. Ein Tisch in der Mitte des Raumes, vier Stühle darum, ein Bildschirm an der gemauerten Wand und ein PC in der hinteren Ecke. Das waren unsere wichtigsten Möbel. Ein gefülltes Bücherregal, das das ehemalige Stahltor verdeckte, und ein Spiegel, auf dem man durch ein raffiniertes Röhrensystem den Eingang im Blick hatte, hatten ihren Platz in der Garage gefunden.
Ich blickte auf meine Armbanduhr. Es war vor fünf Minuten, dass ich Rosy angerufen hatte. Wenn sie sich beeilt, müsste sie in den nächsten Minuten kommen. Doch ich kannte ihre Mutter nur zu gut. Sie legten sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Darunter konnte man die Regel »Es wird erst gegangen, wenn alles aufgegessen ist« finden. Spätestens, wenn Sam ihnen alles erklärt hatte, würde sie Rosy gehen lassen. Also trabte ich zum Bücherregal, zog den dicken Wälzer Leben im Auge des Todes heraus und ließ mich auf meinen knautschigen Lieblingssessel nieder. Das Lesezeichen lag auf Seite 253.
Der Wind peitschte im Flug durch meine Haare. Fill trug mich wie auf Kissen über die Lavafelder. Dort, weit in der Ferne, sah ich die Umrisse des riesigen Schlosses, wo er irgendwo sein musste und auf mich wartete. Ja, er muss mich im Kampf schlagen. Ich würde dem Tod nicht meine Stirn hinhalten und wie ein kleines Kind darauf warten, bis es passierte. Ich würde kämpfen und so viele Leben retten, wie es nur ging.
Ich schlug das Buch zu. Das konnte mich jetzt schwerlich aufheitern. Ich ließ es langsam sinken. Was wäre, wenn sich Stev auf solch einer Reise befand? Auf einer Reise in den Tod?
Das Klimpern an der Tür riss mich aus meinen Gedanken.
Ein schönes rothaariges Mädchen mit leuchtend blauen Augen trat ein. Sie war in eine schwarze Daunenfederjacke eingehüllt und hielt ihr Handy in der Hand. In vielerlei Hinsicht ähnelte sie meiner Mutter erschreckend stark.
»James! Was ist denn los? Wieso geht es um Leben und Tod?«
Sie sah gehetzt und angespannt aus. Ihre Mundwinkel zuckten leicht und ihre Augen hefteten sich fest an mich.
»Stev und seine Eltern wollten heute zu uns kommen. Simone und Alfred kamen pünktlich, Stev jedoch wollte mit dem Fahrrad her radeln, wurde aber auf dem Weg hierher angegriffen.«
»Angegriffen?!«, fragte Rosy entsetzt.
»Ja. Vermutlich von den Fosit. Rosy, weißt du etwas über die Kobruswölfe?«, hakte ich nach, gespannt das Buch umklammernd.
»Mir hat William nur gesagt sie seien eine von den Fosit gezüchtete Wolfsart«, sagte sie mit erstickter Stimme. Ich nickte.
»Gut. Denn wir glauben, das Stev von so einem Kobrus angefallen wurde. Stev liegt in einem Art Trauma in meinem Bett und John versucht etwas mehr über diese Wolfsart herauszufinden.«
Sie ließ sich auf einen Stuhl sinken und starrte mich entsetzt und ungläubig an.
»Die Fosit… warum?«, murmelte sie.
»Das haben wir uns schon gefragt. Vielleicht hängt das mit meinem Icerotes zusammen«, sagte ich und stellte das Buch zurück in das Regal.
»Stimmt ja, du hast dein Icerotes bekommen. Darf ich es sehen?«, fragte sie mit ganz anderer Stimme. Ich nahm mein Icerotes hervor und reichte Rosy den Griff.
»Sein Name ist Libras. Frag nicht, was mein Schicksalsspruch ist. Wir konnten ihn nicht entziffern«, erklärte ich.
»Nicht? Das ist ungewöhnlich.«
Sie gab mir Libras zurück und schloss ihre Augen.
Schließlich sagte sie: »Kann ich zu Stev?«
Zügig gingen wir zurück ins Haus. Dabei sah ich einen Angler nicht allzu weit weg am Bach sitzen. Er war ziemlich korpulent und trug eine karierte Bommelmütze auf seinem Glatzkopf. Eine altmodische Gaslaterne erhellte ihn und seine Umgebung. Ich bezweifelte, dass er hier, zu dieser Jahreszeit, größere Fische fangen würde. Schweigend saß er da und lauschte dem Plätschern des Wassers.
Das glaubte ich zumindest. Seine Angelrute hatte er am Ende in den Boden gesteckt, doch der Faden regte sich nicht.
»Was macht der noch um diese Uhrzeit hier?« fragte Rosy, als sie ihn bemerkt hatte. Ich zuckte die Schultern.
Vor der Haustür kniete Mina. Sie hielt eine Vase mit frischen, schönen Tulpen in den Händen. Was suchten diese Blumen hier im Freien? Ich kannte mich zwar gar nicht mit Blumen aus, zumindest wusste ich, dass Tulpen im Herbst nicht im Freien stehen sollten. Verwirrt ging ich an ihr vorbei.
John saß noch in unserer Hausbibliothek, ein Telefon an der Ohrmuschel und die Augen an den Bildschirm des PCs geheftet.
»Dad, hast du schon…« fing ich erwartungsvoll an, woraufhin mein Vater zischte und seine Hand hob, um mir Schweigen zu gebieten
Ich bedeutete Rosy, sich zu setzen. Kurz darauf verabschiedete sich mein Vater von seinem Gesprächspartner und legte den Hörer zurück.
»Und?«, fragte ich gespannt. »Kennt der australische Anführer den Kobrus?«
Zu meiner großen Freude lächelte John – oder machte er die Andeutungen dazu.
»Zum Glück konnte mir mein alter Freund etwas erklären.«
Rosy und ich lauschten gebannt und er fuhr fort: »Er berichtete mir, die Kobrus seien eigentlich in Südaustralien beheimatet und nicht in Amerika. Sie wurden nur in die Vereinigten Staaten importiert.«
»Und das heißt?«, fragte Rosy.
»Das heißt, Lesar kennt sich mit dieser Wolfsrasse aus. So erklärte er mir, dass das Gift den Menschen in eine Art Starre versetzt. Als Winterschlaf könnte man es bezeichnen. Das Gegengift ist das Öl der sogenannten Kolibripflanze, welche ziemlich selten ist und nur in einem ganz bestimmten Gebiet auf dem australischen Kontinent wächst. Da es so selten gebraucht wird und nur schwer zu beschaffen ist, gibt es das Öl nicht auf Vorrat. Dennoch braucht Stev das Gegengift. Denn irgendwann wird seine Körperenergie vollends aufgebraucht sein. Und das heißt…«, seufzte John, doch ich beendete den Satz optimistisch: »…dass wir nach Australien müssen.«
Rosy ließ den Kopf hängen und um die unruhige Stille zu brechen, fragte ich zweifelnd: »Kann nicht Lesar das Gift für uns besorgen?«
»Das soll eine ziemlich schwierige Aufgabe sein. Und eine riskante dazu. Man muss viel Glück und einen erfahrenen Kopf haben, um sie finden zu können«, erklärte John.
»Willst du etwa mit ansehen, wie das Leben aus Stev heraus sickert, Dad? Du magst ihn genau so sehr wie ich«, fuhr ich meinen Vater an, härter als ich eigentlich beabsichtigt hatte.
»Es ist schwer. Die ganze Organisation, die Hilfe, die wir benötigen werden, die Zeit. Es dauert eine halbe Ewigkeit, um nach Australien zu fliegen. Bis wir die Pflanze gefunden haben und wieder zurück sind… Wer weiß, ob Stev überhaupt noch so viel Zeit bleibt?«, murmelte mein Vater.
»Dennoch. Wir werden es versuchen müssen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wir müssen nach Australien.«
Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)