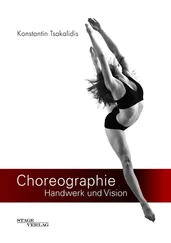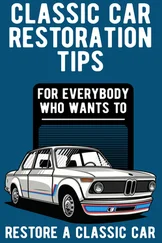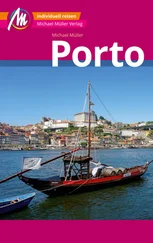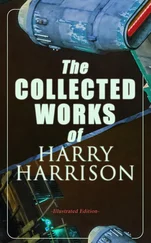John war, wie nicht anders zu erwarten war, nicht anwesend. Ich nahm Libras aus der Hülle und legte ihn neben meinen Teller. Immer noch überkam mich in meinem Unterbewusstsein eine Flut von Glücksgefühlen wenn ich ihn sah. Der einzige, der derzeit in meiner Generation des Murexstammes auch noch ein Icerotes besaß, war William. Er war der Älteste von uns Vieren. Stev dagegen war der Jüngste. Mehr Nachkommen meiner Generation, des Murexstammes, gab es nicht. Nur uns vier. Kein anderer Stamm hatte eine derart geringe Nachwuchsrate.
Wir alle gingen in dieselbe Schule. Da sich die Mitglieder des Murexstammes in der nördlichen Schweiz, hier um Waldhusen herum, angesiedelt hatten, hatte man etwas außerhalb des Dorfes eine kleine Schule eingerichtet. Bei den normalen Menschen war sie als Privatschule bekannt und tatsächlich fungierte sie so ähnlich. Es gab gut zehn Schüler. Meine drei Freunde und ich wurden von zwei Lehrern, die der Asgardtfamilie angehörten, in jedem Fach unterrichtet. Über die normalen Fächer hinaus gab es noch geschichtliche Entwicklung der Asgardtfamilie, Icrologie - einer Unterrichtseinheit, die sich mit der Lehre der Icerotes befasste – und Astronomie. Astronomie war in der Asgardtfamilie überhaupt sehr angesehen und gefragt. Vielleicht, weil die Wissenschaft der Icerotes so nah mit dieser Wissenschaft verwandt war.
Neben uns gab es noch sechs jüngere Schüler und Schülerinnen. Meistens waren sie Cousins und Cousinen oder entferntere Verwandte. Insgesamt zählte der Murexstamm etwa vierzig Personen als Mitglieder, von denen zwölf noch minderjährig waren. Nun waren Herbstferien und vor mir und meinen Freunden lagen zweieinhalb Wochen Ruhe und Entspannung.
Die Finleys wollten um fünf Uhr kommen und ab halb vier wusste ich nicht mehr, was ich zu tun hatte.
Gelangweilt lag ich in meinem Zimmer auf dem Bett, Libras in den Händen haltend und ihn langsam durch die Luft schwingend. Dabei gab es immer Augenblicke, in denen die abendlichen Sonnenstrahlen von der bronzenen Klinge geschnitten wurden. Dann schimmerte sie golden auf und der eingravierte Schriftzug machte den Eindruck, als würde er von innen heraus glühen.
Was für ein Wesen waren die Icerotes?
Wie oft hatten sich Asgardtler diese Frage schon gestellt? Wie oft hatten wir diese Frage schon in der Schule behandelt? Ich konnte es nicht sagen. Jedenfalls hatte man noch nie eine mehr oder weniger annehmbare Antwort darauf geben können. Denn es musste der Wunsch der Icerotes sein, dass wir sie nicht verstehen konnten, dass wir immer noch, nach all den Jahrtausenden interessiert an ihnen waren, sie als lebenswichtig ansahen. Ohne uns würden sie vermutlich nicht mehr auf dem Planet Erde vertreten sein. Woanders bestimmt noch, hier aber nicht mehr.
Als die Drei bei Abenddämmerung an unserer Haustür läuteten, stürzte ich aus meinem Zimmer, um Stev zu empfangen, doch Mina hatte sie schon geöffnet und mit einem »Ach, meine Liebe«, umarmte sie Simone, Stevs Mutter, gab Alfred zwei Küsschen auf die markanten Wangen und führte sie, wie es einmal mit Erwachsenen so war, mit viel Händegefuchtel hinein. Doch Stev war nicht bei seinen Eltern.
»Wo ist Stev?«, fragte ich sie zur Begrüßung misstrauisch, worauf Mina eine missbilligende Mine aufsetze. Die Finleys schien es nicht zu kümmern.
Freundlich sagte Simone, während sie ihr Übergewand auf einen dreibeinigen Hocker legte: »Stev meinte, er wolle mit Odin eine Fahrradtour machen und später zu uns stoßen.« Sie schaute auf ihre schwarze Armbanduhr, die sie zu ihrem letzten Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen hatte. »Allerdings sollte er jeden Moment hier eintreffen. Zumindest wollte er versuchen rechtzeitig herzukommen.«
Ich stellte mir Stev vor, wie er auf seinem Rennrad über die umliegenden Wiesen raste, den kleinen schneeweißen Labrador Odin neben sich her tollend. Er liebte das Fahrradfahren, mehr als wir alle.
Inzwischen hatte sich John zu der Truppe an der Türschwelle gesellt. Seine Haare waren noch feucht. Anscheinend hatte er schnell geduscht und schon wurde er von Simone in die Zange genommen.
Während die Erwachsenen Richtung Terrasse gingen, trat ich einen Schritt aus der Haustür und schaute mich nach meinem Freund um. Doch sowohl auf der langen Einfahrt, als auch auf der etwas weiter hinten liegenden Wiese fehlte von Stev jede Spur.
Unser Tisch auf der Terrasse war von Mina wundervoll gedeckt worden. Orchideen und exotische Tulpen ragten in der Mitte des Tisches auf und die Glasteller spiegelten das Licht der flackernden Kerzen. Ich setzte mich mit dem Rücken zum kleinen Bach, der hinter unserem Anwesen Richtung Waldhusen floss, damit ich die Einfahrt gut im Blick hatte. Mina bestand darauf, mit dem Essen auf Stev zu warten, doch nach über einer halben stevlosen Stunde mussten wir mit der Vorspeise beginnen.
Ich bekam kaum einen Bissen hinunter. Was wäre, wenn Stev vielleicht etwas zugestoßen war? Mir fiel auf, dass sich Stevs Eltern kaum Sorgen zu machen schienen. Sie warfen einzelne Blicke um sich, doch ansonsten machten sie einen ganz gelassen Eindruck.
Ein Stein fiel mir vom Herzen als es an der Haustür klingelte. Ich sprang auf, eilte zum Eingang und hatte schon die Klinke umklammert, als ich plötzlich stutzte. Die ganze Zeit hatte ich die Einfahrt, auf der Stev eigentlich entlang kommen müsste, im Blick gehabt. Doch ich hatte Niemanden gesehen.
Misstrauen packte mich. Mit einer Stimme derart autoritär verstellt, wie ich es nur aufbringen konnte, fragte ich: »Wer da?«
»James, mach'… bitte auf.« Stevs Stimme, gedämpft von der Tür, klang flehentlich und erschöpft. Ich riss die Tür auf und erstarrte.
Stev stand vor mir, die Leine von Odin in der Hand. Doch sah Stev gar nicht aus wie der Stev Finley, den ich nur zu gut kannte. Mein sonst so gepflegter Freund machte vielmehr den Eindruck eines streunenden Köters. Stevs Gesicht war von blutenden Kratzern und Schrammen überzogen. Seine kurzen tiefschwarzen Haare standen in allen Himmelsrichtungen ab, das T-shirt war an Armen und Brust zerrissen und er war von oben bis unten mit Schlamm verdreckt. Ich half ihm herein und seufzend ließ er sich auf den Mantel seiner Mutter fallen.
»Wasser«, stöhnte er und schloss seine Augen. Ich rannte durch den Flur und ließ in der Küche das Wasser in ein Glas laufen. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich es fast nicht halten konnte. Der Schreck steckte immer noch in meinen Gliedern.
Stev trank es gierig leer. Das eiskalte Wasser rann ihm die Kehle hinab und sein hastiges und unregelmäßiges Atmen beruhigte sich leicht. Seine braunen Augen sahen merkwürdig leer aus und ein Krächzen drang aus seinem Mund: »Du, William… ihr müsst…«
Doch dann, ganz langsam, wurde Stevs Griff um das Glas ruhiger, nicht mehr ganz so verkrampft. Plötzlich glitt es ihm aus der Hand und zerbrach auf den cremefarbenen Fliesen. Daraufhin rutschte Stev mit seinem Kopf von der Wand ab, kippte vorn über und blieb, mit dem Gesicht nach unten, regungslos liegen.
»Alfred, Simone, kommt her, schnell!« John stand hinter mir, anscheinend vom Klirren des Glases angelockt.
»James, was ist…?« Ein Aufschrei von Simone unterbrach ihn, die durch den Flur auf ihren Sohn zu rannte, der für sie, da er so regungslos da lag, tot zu sein schien. Ich stand wie angewurzelt da, konnte keinen Muskeln mehr rühren. Was war mit Stev?
»Nur die Ruhe, Simone.«
John hatte sie festgehalten und versuchte nun, sie zu beruhigen. Doch sie schlug mit ihren Armen um sich, schluchzte und schrie sich ihr Elend aus dem Leib.
»Er ist nicht tot!« Alfred hatte sich zu seinem Sohn hinuntergebeugt und hielt seine Finger an die Hauptschlagader von Stevs verkrampften Hals.
Ich fand meine Stimme wieder und fragte zittrig: »Ist er ohnmächtig?«
»Das müssen wir hoffen. Tot ist er auf jeden Fall nicht. Sein Puls schlägt. Aber schlafen kann er auch nicht. Dafür ist sein Atem zu unregelmäßig. Doch diese These spricht gegen einen Ohnmachtsanfall. Ich schlage vor, wir bringen ihn hoch in dein Bett, James.«
Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)