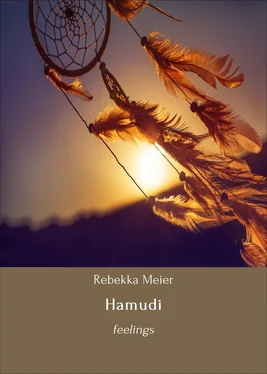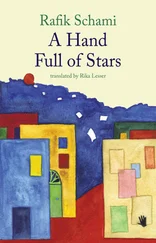Zen – bedrückt

Zen konnte sich nicht bewegen. Sein Körper war leblos – so wie sein Geist. Der selbe Tagesablauf tagein, tagaus fühlte sich an, wie eine schwere Last auf der Seele. Er schlief viel. Meist am Tag, da war es ruhiger im Haus. Er wollte nicht in die Schule, er sah keinen Sinn darin, hier Deutsch zu lernen. Er wollte ohnehin nicht bleiben. Aber wohin sollte er? Zu seinen Freunden, oder nach Hause? Zen fühlte sich wie erschlagen. Mit seinen großen braunen Augen und seiner hellen Haut sah er aus wie ein Gespenst. Da er tagsüber nicht aufstand, überkam ihn nachts der Hunger. Allerdings gab es zu dieser Zeit nichts mehr zu essen. Manchmal half der Schwarztee mit viel Zucker darüber hinweg. Die Tage waren lang, wenn man sie zählte. Wenn sein Geist fitter war, überlegte er sich Fluchtpläne nach Deutschland. Es hatte sich herumgesprochen, dass man in Deutschland nicht ausgewiesen wurde, wenn man unter achtzehn war. Zen war siebzehn. Dazu kam, dass Zen seinen Freund Denga vermisste. Er war achtzehn geworden und wurde in eine andere Unterkunft gebracht. Er war für ihn jetzt weit entfernt. Es waren fast vier Stunden mit dem Zug und dem Bus und nicht leistbar. Schon mit der Hinfahrt hätte er sein gesamtes monatliches Geld verbraucht. Damit war sein Freund jetzt für ihn verloren. Mit Denga konnte er seine Sorgen besprechen. Außerdem gab er ihm durch die stattliche Größe und seinen durchtrainierten Körper, die Sicherheit, die er jetzt vermisste. Denga war jetzt in einer Unterkunft für junge, erwachsene Männer. Der Kontakt war nur mehr über das Internet möglich. Die körperliche Nähe, seine Anwesenheit und seine Stimme fehlen ihm sehr. Für was sollte er aufstehen? Zen hatte jegliche Perspektiven verloren. Umso mehr verstärkte sich sein Wunsch zu fliehen. Oder wäre es besser zu sterben?
Abends raffte sich Zen meist zu einem Spaziergang auf. Seine Spaziergänge waren lang und er hatte seinen Lieblingsplatz gefunden. Es war eine Bank, die ihm die freie Sicht auf die Berge vermittelte. Aber er konnte auch auf den Friedhof sehen und in seinen stundenlangen Dialogen mit sich selbst, kam er zu dem Ergebnis, dass er lieber unter den Toten wäre, statt unter den Lebenden. Er vermisste das Leben in seiner Stadt am Mittelmeer. Die Straßen hier erschienen einsam, es gab Wenig zu sehen und bei seinen alltäglichen Runden traf er nur selten auf Menschen. Was machten die Menschen hier, wo waren sie, wo trafen sie sich? Die Sehnsucht nach seiner Mutter und seinen Freunden war inzwischen so groß geworden, dass sie weh tat. Zen hatte probiert, sich mit Vodka zu betäuben. Aber der Versuch scheiterte kläglich. Er konnte sich, nach einer Flasche davon nicht mehr bewegen und die Nachwirkungen am nächsten Tag waren dermaßen drastisch, er kotzte den ganzen Tag, dass er auch davon abließ. Seine Stimmung wurde daraufhin noch schlechter – am Tiefpunkt angekommen. Er begriff, dass Alkohol nichts für ihn war und beschloss es wieder zu lassen. In seinem Herzen lodert ein kleiner Hoffnungsschimmer. Es gibt da zwei nette Mädchen, die sich um einige der Jungs kümmerten. Als Zen Geburtstag hatte, veranstalten sie für ihn eine Geburtstagsparty. Sie backten einen Kuchen und feierten seinen Geburtstag. Zusammen mit seinen Freunden. Zen fühlte sich seit langem wieder wahr genommen und wertgeschätzt. Es war eine der wenigen Situationen, in der er lachte und Freude empfand. Auch der Abend in der Disco war in seiner Erinnerung. Zen hatte viel Spaß. Es war bis jetzt einer der wenigen Abenden, in seinem neuen Leben in Österreich, an dem er nicht grübelte und sich sorgte. Auf seiner Lieblingsbank sitzend, umgeben von starken Eichen, den Blick zwischen den Bergen und dem Friedhof hin und her schweifend, flogen plötzlich zwei Schwäne über seinem Kopf hinweg. Sie nahmen Kurs auf die Weite und Zen überkam ihn diesem Augenblick eine Gefühl, dass ihn in den nächsten Monaten nicht mehr ausließ. „Ich muss hier weg“, beschloss er für sich, weiter nach Deutschland. Weiter in eine größere Stadt mit mehr Menschen und mehr Verständnis. Er wollte sich frei bewegen und in einer Menschenmenge untergehen. Er hasste es, angestarrt zu werden und hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, die Kapuze seines Pullovers weit in sein Gesicht zu ziehen. Mit dem Blick auf den Boden gerichtet, handelte er wie ein kleines Kind, das glaubt, wenn es sich die Augen zuhält, kann es niemand sehen. Für die Leute im Dorf wirkte er dadurch nur noch unnahbarer und distanzierter. Er spürte, dass er bei vielen nicht willkommen war.
Meris – deprimiert

Meris saß traurig und einsam in seinem Bett und drehte sich eine Zigarette. Er war ein schmaler Bursche, die Körperhaltung ließ auf geringen Selbstwert und Aufgabe schließen. Man sah ihm seine Verzweiflung an, ohne sein Gesicht zu sehen. Bis jetzt hatte er die Hoffnung nie aufgegeben, versuchte immer das Beste aus jeder Situation zu machen. Umgeben von seinen Freunden war das alles einfacher. Doch die wurden immer weniger und er hatte Angst alleine übrig zu bleiben. Manche waren schon 18 und wollten sich eigenständig eine Wohnung suchen, die anderen wollten weg, in andere Städte, sie hofften auf mehr Möglichkeiten anderswo. Meris sehnte sich nach einer Beschäftigung. Er war es gewohnt zu arbeiten. Schon mit dem Alter von 14 arbeitete er jeden Tag von Montag bis Sonntag von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Außer Freitags. Am Freitag hatte er immer frei und traf sich mit seinen Freunden zum Radfahren. Er war Meister im Willi machen. Er konnte auch Moped fahren und liebte es Fußball zu spielen. Es war ihm zu wenig, zwei Stunden pro Tag den Deutschkurs zu besuchen und die restliche Zeit tot zu schlagen. Die Wartezeit betrug jetzt schon zehn Monate und es war noch immer kein Land in Sicht. Er war nicht der Einzige, der wartete. Kurzzeitig hoffte er darauf, in einem Fußballverein spielen zu können. Aber niemand wollte ihn. Viele in der Umgebung hatten Angst und wollten Abstand von dem Flüchtlingsgeschehen. Jetzt sah er auch diese Möglichkeit einer Beschäftigung gestorben. „Für was, all das?“, dachte er immer öfters. Dann kam ihm seine Familie in Damaskus in den Sinn und sein Glaube, der ihm verbot, aufzugeben. Meris raffte sich auf und zog sich an. Sein Äußeres war sehr gepflegt und er war ein Beispiel dafür, dass man auch mit wenig Geld und Kleidung, ordentlich aussehen konnte. Das Gelen der Haare war Standard für ihn, er legte, genauso, wie seine Freunde, viel Wert auf seine Erscheinung. Die Uhr zeigte 7:40. Er war immer sehr knapp. Er verstand selbst nicht, warum er hier immer so schwer aufstand. Anfangs schaffte er es selten in die Schule, die Depressionen hielten ihn in seinem Bett. Jetzt war es besser. Er war stolz darauf, nicht aufgegeben zu haben. Er wollte Rebekka nicht enttäuschen. Sie war immer freundlich und hilfsbereit zu ihm und er mochte die Deutschstunden mit ihr. Vielleicht wusste sie einen Rat. Er konnte sich nicht vorstellen, noch ein Jahr hier zu warten. Meris fand Rebekka von der ersten Sekunde an sympathisch. Er war erstaunt über die Kraft und Energie, die diese Frau ausstrahlte. Sie versuchte immer zu scherzen und Lösungen für Situationen der Jugendlichen zu finden. Für einige der Burschen war sie eine Art Tante. Sie konnten mit ihren Fragen und Problemen zu ihr kommen und Rebekka versuchte ohne Wertung, gemeinsam mit ihnen Wege zu finden. Meris konnte sich noch gut erinnern, wie sie ihnen die Kultur und die Werte von Österreich vermittelte. Sie hatten viel Spaß dabei und es war interessant sich auszutauschen und zu erfahren, was in diesem Land üblich war und was man besser sein ließ. Außerdem gestaltete sie ihren Unterricht abwechslungsreich. Rebekka war wirklich bemüht, dass die Jungs Deutsch lernten und betonten auch immer wieder, dass es absolut notwendig war, die Sprache zu beherrschen. Alles hing von der Sprache ab. Das Lernen fiel Meris schwer. Er arbeitete lieber und lernte Deutsch besser vom Hören, als vom Schreiben. Leider hatte er wenig Gelegenheit sich in Deutsch auszutauschen. Nach den 2 Stunden Deutsch am Tag kam er nicht mehr in den Genuss mit Einheimischen zu reden. Im Heim wurden viele Sprachen gesprochen, aber wenig Deutsch. Mit Österreichern hatten sie wenig Kontakt. „Bitte lass mich eine Arbeit finden!“, betete er, schnappte sich seinen Schulrucksack und machte sich auf zu Rebekka, mit dem Gedanken, ihr von seinen Plänen zu berichten.
Читать дальше