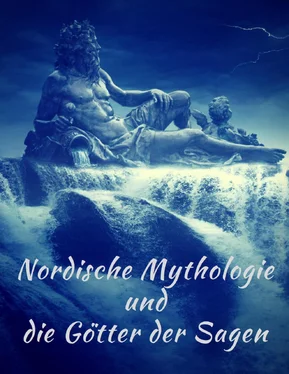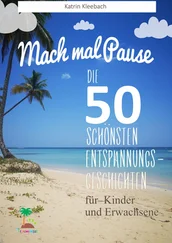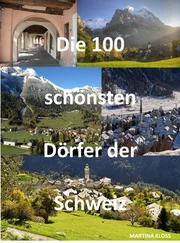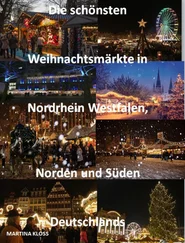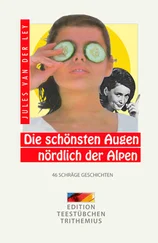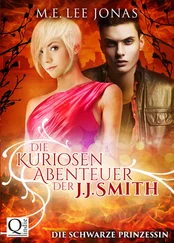Wir sahen, es gelang Thor nicht, das Ungeheuer zu erlegen; sie riss sich los, als er sie geangelt hatte. Zwar floh sie, schwer verwundet, in den tiefsten Grund des Meeres; aber dereinst wird sie, wieder heil und mutig, abermals »Riesenmut« annehmen und »Land suchen«. In sehr vielen Gegenden, in der Nähe von Seen, wirkt diese uralte Vorstellung nach; in dem Grunde des Sees liegt schlafend, wund, gefesselt ein furchtbarer Wurm, Drache, Fisch; am jüngsten Tage (christlich ausgedrückt), oder wenn Gottlosigkeit, Unglaube, Üppigkeit in der nahen Hauptstadt den äussersten Grad erreicht haben, wird sich der Drache losreissen, bei seinen gewaltigen Bewegungen tritt der See über die Ufer, und Wasser und Wurm verschlingen alles Leben in der sündhaften Stadt (so vom Walchensee und von München erzählt).
Ein riesischer König, ursprünglich riesischer Gott des Meeres ist Hlêr oder Ögir (wohl derselbe wie Gymir). Seine Gemahlin ist Ran; eine (selbst riesische) im Wasser hausende Todesgöttin, Hel ganz ähnlich, nur auf die durch Ertrinken Sterbenden beschränkt. Ihr Reich ist der Grund des Meeres (in diesem Sinne heisst sie auch wohl »Haf-frau«) und andrer Gewässer; hier hält sie die Seelen der Ertrunkenen fest, welche sie mit ihrem Netz aus Schiffen oder bei dem Baden oder im Schwimmen in die Tiefe zieht, hinabraubt (dem entspricht ihr Name, der »Raub«, rapina, bedeutet, daher heisst fara til Rânar, ertrinken [zur See], sitza at Rânar [sitzen in Rans Reich], ertrunken sein; Ran wäre althochdeutsch: Rahana, ähnlich wie Tanfana, Hludana). Die neun Töchter von Ögir und Ran bedeuten: »Wellen«, »Flut« und andre Erscheinungen der Gewässer.
Das Meer spielt bei allen Küsten- und Insel-Germanen eine so gewaltige Rolle, dass die die Wanen verehrenden Völker eines (wanischen) Meergottes nicht entraten mochten; er ist Niördr (aus Noatun), der Vertreter des friedlichen, der Schiffahrt diensamen, den Menschen wohltätigen Meeres. Aber auch mit Ögir pflegen die Asen Gastverkehr; alljährlich zur Zeit der Lein-Ernte (im September), wann mildere Winde (Beyggwir und Beyla) walten und die Schrecken des Meeres ruhen, besuchen die Götter Ögir in seiner Halle im Grunde der See, welche, in Ermangelung von Tageslicht, von Goldlicht (schwerlich doch Bernstein! Eher das Meerleuchten, welches dichterisch auf die vielen in der See versunkenen Schätze zurückgeführt wird) beleuchtet wird. Seine Diener heissen daher Funa-fengr (Feuer-fänger) und Eldir (Anzünder).
Ein Wasserriese ist auch jener Grendel, welchen Beowulf in seiner Jugend erlegt (s. unten Beowulflied). Er und seine noch furchtbarere Mutter (wie ja auch im mittelalterlichen Schwank des Teufels Frau, Mutter oder Grossmutter noch ärger erscheint als der Teufel) sind die Sturmfluten, welche im Frühling die Küsten der Nordsee (wo diese Sage entstand) bedrohen. In hohem Alter tötet Beowulf auch noch einen Drachen, der das Land verwüstet und ausraubt, sinkt aber selbst, auf den Tod verwundet, zusammen; es sind die Herbsthochfluten, welche die Ernte, den Reichtum des Landes, rauben wollen; Beowulf, alt geworden, stirbt, nachdem er auch diesem Feinde gewehrt. Ursprünglich war es der Sonnengott Freyr, der, im Frühling jung, im Spätherbst gealtert, jene Unholde bekämpft; erst später ward aus dem göttlichen Helden der halb-göttliche Beowulf.
Grosse Helden und Königsgeschlechter stammen oft von Meer-Riesen oder Meer-Elben ab, welche die am Strande wandelnden Königstöchter mit Gewalt sich zum Weibe genommen; wie Ortnit und Dietrich von Bern wird auch das geschichtliche Königshaus der salfränkischen Mero-vinge auf einen solchen Meer-wicht zurückgeleitet. Wieland der Schmied (s. diesen unten) war ein Sohn Wates, der im Gudrun-Lied als Heermeister der Hegelinge auftritt, ursprünglich aber ein Wasserriese war, durch dessen »Waten« die Wiederkehr von Flut und Ebbe bewirkt ward; er gilt als Sohn der Wasser-Minne (d. h. Elbin) Wâchilt; später ward er mit Christophorus, dem watenden Träger Christi, zusammengebracht. Ein andrer Meer-Riese ist der Gebieter der Walfische, welche er, als seine Eber, in das hohe Meer führt.
Wasser-Riesen, aber nicht Meer-Riesen, sondern Vertreter verderblicher Bergströme, welche in reissenden Wirbeln mit mehrfachen (z. B. acht) Armen Bauland, Gehöfte, Herden, Menschen verschlingen, sind Hergrim und Starkadr. Letzterer, »achthändig«, besiegt den schwächeren Giessbach Hergrim im Kampf um ein Mädchen, Alfa-sprengi, das Starkadr verlobt, aber von Hergrim mit ihrem Willen entführt war; nachdem Hergrim gefallen, tötete sie sich selbst, um nicht Starkadr anzugehören: »ein schimmernder Staubbach, um den sich zwei benachbarte Stromriesen zu streiten scheinen«. Starkadr riss alle fahrende Habe Hergrims an sich: »der mächtigere Strom reisst die Wasserschätze des Besiegten an sich«. – Auch den Sohn Hergrims und Alfasprengis nimmt er nun in seine Erziehung; einen aus der Vereinigung der beiden entsprungenen Bach reisst der stärkere Strom an sich. Starkadr raubte nun Alf-hild, die Tochter Königs Alfs von Alfheim (natürlich eine Elbin; abermals ein Gewässer? oder eine fruchtbare Flur?), ward aber von Thor getötet, indem ihn der Gott von einem Felsen stürzte; der dem Ackerbau höchst verderbliche Bergstrom wird durch den mittels Wasserbauten das Bauland schützenden Gott des Ackerbaues über einen Fels hinabgeleitet.
Winter-Riesen gar mannigfaltiger Art und Benennung zeigen uns recht deutlich, wie stark der im hohen Norden dem Menschen und seinem Leben und Wirtschaften so machtvoll widerstreitende Winter, dessen Besiegung durch den lichten warmen Frühlingsgott den Inhalt so vieler und der bedeutsamsten Sagen ausmacht, die Vorstellungen der Germanen, zumal eben der Nordgermanen, beschäftigte. Die Winter-Riesen sind Reif-Riesen, Hrim-thursen, wobei »Reif« für »Kälte«, »Frost« überhaupt steht; Ymir, der älteste aller Riesen, war ja aus Eisströmen erwachsen, er ist besonders der Reif-Riesen Ahnherr. Gar mancher Riesen Namen sind daher mit »Hrim«, Reif, zusammengesetzt. Gletscher dröhnen, wann der Winterriese Hymir eintritt; sein Kinnwald ist gefroren, der Pfeiler zerspringt vor seinem Blick, d. h. »die Kälte sprengt das Holz der Bäume« (Uhland).
Wie der Feuer-Riese und der Meer-Riese ist auch der Luft-Riese Kari ein Sohn des Alt-Riesen Forn-jotr. Die Luft, sofern sie den Menschen und ihrer Wirtschaft feindlich, ist riesisch; – sofern wohltätig und Ausdruck des Geistes, ist sie asisch und in Odin dargestellt. Die feindliche Luft erscheint aber einmal als Sturm (daher die zahlreichen Sturm-Riesen: Hräswelgr, Thiassi, Thrym, Beli); dann als Kälte, Winterluft; daher stammen von Kari als Winterluft Frosti, Jökull (Eisberg), Snôr (Schnee), Fönn (dichter Schnee), Drîfa (Schneegestöber), Miöll (feinster, glänzendster Schnee). Manche dieser Gestalten sind wohl blosse Gebilde der Skalden und ohne Wurzeln im Leben des Volks. Doch werden von einigen einzelne anmutige Sagen erzählt: König Snio (Schnee) von Dänemark wirbt um die junge Schwedenkönigin; heimlich flüstert sie mit seinem Boten, auf Wintersanfang verabreden sie geheime Begegnung. Frosti entführt Miöll, die »lichtgelockte« Tochter des Finnenkönigs Snär; er fasst sie unter dem Gürtel, rasch fahren sie im Winde dahin.
Thiassi war der Sohn Äl-waldis, des »Bier-Bringers«. Als dieser starb, teilten sich Thiassi und seine beiden Brüder Idi und Gângr in der Weise in das Erbe, dass jeder je einen Mund voll Goldes daraus nahm. Uhland hat dies so gedeutet: der Bierbringer ist der Regenwind, seine Schätze sind die Wolken; starb der Regenwind, teilen sich die übrigen späteren (d. h. jüngeren) Winde in die Wolken, sie teilen sie mit dem Munde, d. h. sie zerblasen sie. Der heute noch in unsrer Sprache lebenden »Windsbraut« liegt die Sage zu Grunde, dass ein stolzes Mädchen alle menschlichen Freier verschmähte – nur des Windes (d. h. keines) Braut wollte sie werden, hatte sie gelobt. Da nahm sie Odin bei dem Wort, drang des Nachts, die Fenster aufstossend, in ihr Schlafgemach, umfasste die zugleich vor Grauen und Wonne Erbebende und trug sie in seinem dunkeln Mantel weit nach Asgards goldenen Hügeln.
Читать дальше