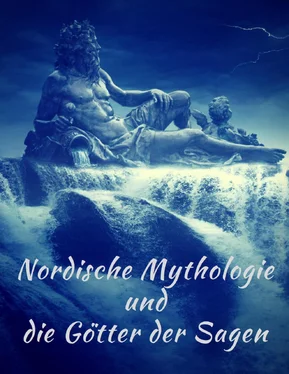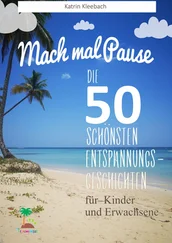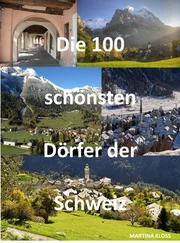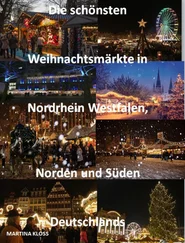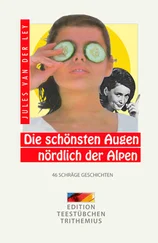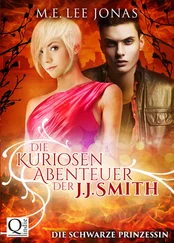Sehr wenig ist es, was wir von einigen andern Göttinnen und Göttern wissen; fast nur, dass ihnen gewisse Monate oder andre Jahresabschnitte geweiht waren. So einer Göttin Spurke der Februar, der nach ihr »Sporkel« hiess; vielleicht war ihr der gleichnamige Wacholderstrauch heilig: »Spörkels Kathrin (oder »Spörkels Elsken«) schüttelt ihre neunundneunzig Röcke« sagt ein Sprichwort am Rhein oder in Westfalen; vielleicht die häufigen Regenschauer und Schneefälle dieses Monats?
Den Nordgermanen aber heisst der Februar Gôi und von dem Weibe, das ihm diesen Namen gab, geht folgende auf Landnahme, Ackerbau und Frühlingsanfang bezügliche Sage. Der alte Riese Fornjotr hatte einen Sohn Kari, dieser einen Sohn Frosti (Frost), dieser einen Sohn Snar (Schnee), dieser einen Sohn Thorri, dem (vielleicht) um Mitt-Winter das Opfer Thorri-blôt gebracht wurde. Sein Sohn Gor gab dem »Schlacht-Monat« den Namen (im November), der andre Sohn hiess Nor; während des Thorri-Festes ward deren Schwester Gôi geraubt. Der Vater entsandte beide Söhne, die Verlorene zu suchen; vier Wochen später brachte er ein Opfer; (»Gôi-blott« –) vermutlich, auf dass die Götter die Wiedergewinnung begünstigen möchten. Gor forschte zur See, Nor zu Lande; Gor fuhr an Schweden vorbei nach Dänemark, besuchte hier seine Gesippen, die von dem Meergott Hlêr (Ögir) stammten, und segelte dann weiter gen Norden. Nor aber wanderte aus Kwenland durch Lappland nach Throndheim. Beide Brüder waren mit Gefolgschaften ausgezogen und hatten sich auf ihrer Fahrt gar manche Landschaften und Eilande unterworfen. Als sie wieder zusammentrafen, verteilten sie das Gewonnene derart, dass Nor das feste Land behielt; – er nannte es Norwegen, Gor aber die Inseln. Endlich fand Nor auch die Schwester wieder; Hrôlf, ein Enkel Thors, hatte sie geraubt aus Kwenland; zur Aussöhnung empfing Nor Hrôlfs Schwester zur Ehe. Da Goi soviel als Gau, d. h. Land ist, erhellt, dass die ausziehenden Brüder Land suchen; die Namen Frost, Schnee, Nord weisen auf Winter-Riesen hin, denen das Bauland durch den Spross des Ackerbaugottes für immer entzogen wird. Das Einzelne der späten und künstlichen Dichtung bleibt aber unklar; die Zusammenfassung von Ansiedlung, Landnahme, Ackerbau, Frühlingsanfang als Stoffgebiete einer Sage musste verwirren. Es ist sehr willkürlich, Hrôlf als Hrôdolf auf den Monat März (in Skandinavien beginnt aber doch im März weder Lenz noch Ackerbestellung!) zu beziehen, weil dieser Monat bei den Angelsachsen »Rhêdemônadh« heisst; auch alamannisch (in Appenzell) Redi-Monat, was auf eine Göttin Hrêde zurückgeführt wird. Der weibliche Schmuck (angelsächsisch Rhedo) weist auf Freyas Brisingamen, das Halsgeschmeide, das wir als die von Gras und Blumen geschmückte Erdrinde kennen lernten.
Eine Frühlingsgöttin war auch Ostara, welche sogar dem christlichen Osterfeste den Namen gegeben hat; der April heisst nach der Göttin ursprünglich, später nach dem meist in diesen Monat fallenden Auferstehungsfest »Ostarmânoth«; sie brachte von Osten her Frühling und aufnehmendes Licht. Die Edda kennt nur den die Himmelsgegend bezeichnenden Zwerg Austri. Aber bei den Südgermanen ward das fröhliche Frühlingsfest in heiteren Spielen gefeiert; die Sonne selber tut vor Lust am Morgen des Ostersonntags drei Sprünge, ursprünglich wohl drei Freuden- (oder Sieges-)sprünge über ihre wiedergewonnene Kraft (oder im Wettkampf mit dem Winterriesen?). »Osterspiel« heisst grösste Freude, daher spricht mittelhochdeutsche Liebesdichtung die Geliebte an: »Du meines Herzens Ostertag«. Die Oster-Fladen, Oster-Stollen, Oster-Stufen, Osterküchel, welche zu dieser Zeit gebacken werden, weisen, wie all’ solches Gebildbrot, auf alte Osterschmäuse; zu diesen musste jeder Hof Beiträge in Früchten oder Fleisch liefern; deutlicher noch bezeugt daher den heidnischen Ursprung dieser Festspeisen, dass in manchen Tälern Oberbayerns, z. B. in der Jachenau, die einzelnen Gehöfte in Wechselreihe verpflichtet sind (- oder doch vor wenigen Jahren verpflichtet waren –) zu gemeinschaftlicher Verzehrung einen Widder zu liefern, dessen Hörner mit Bändern geschmückt und mit Rauschgold überzogen waren; wir wissen aber, dass bei Opferfesten horntragenden Tieren die Hörner »vergoldet« wurden. Deshalb wird bei dem Osterschmaus auch der »Oster-sahs« genannt; das Oster-Messer, mit dem das Opfer geschlachtet worden. Ähnliche Verpflichtungen gelten zu Ostern oder Himmelfahrt in andern Landschaften. Dass die Ostereier nicht von einer gewöhnlichen Henne, sondern vom Osterhasen (genauer: von der Frau Häsin) gelegt werden, erklärt sich ebenfalls nur aus der Bedeutung der Göttin Ostara; dieser, als einer Frühlings- und Liebesgöttin, war der Hase wegen seiner Fruchtbarkeit heilig. Dass die Ostereier – die richtigen – rot sein müssen, rührt daher, dass Rot die dem Donnergott geweihte Farbe ist, das erste Gewitter aber galt als Frühlingsanfang, als Tag des Einzugs von Frau Ostara. Die Osterfeuer, welche in norddeutschen Landschaften angezündet werden, sind die Scheiterhaufen des von dem Frühling besiegten und getöteten Winterriesen, welcher nun verbrannt wird nach altgermanischer Bestattungsweise; Judas Ischariot, der manchmal dabei ins Feuer geworfen wird, ist nur der von der Kirche eingeführte Ersatzmann für den Winterriesen, welcher in andern Gegenden heute noch als zottige Pelzpuppe, mit Schneeschaufel und Schlitten ausgestattet, in die Flammen geschleudert wird, in Festhaltung der ursprünglichen Bedeutung. Noch im späten Mittelalter musste der Pfarrer am Ostersonntag nach der Frühpredigt von der Kanzel herab dem Volk einen Schwank, ein lustig »Ostermärlein« erzählen. Das Volk wollte die Kurzweil nicht missen, welche zu der heidnischen Zeit das Osterspiel gewährt hatte; und so schlugen die Leute denn nun in der Kirche ihr »Ostergelächter« auf.
Dagegen eine Sommer- oder Erntegöttin war Thors Gemahlin Sif.
Loki schor ihr hinterlistig das Haar ab; jedoch Thor zwang ihn, Ersatz zu schaffen. Da liess Loki von den Schwarzelben in der Erde ihr neue Haare von Gold machen, welche wachsen (und geschnitten werden) konnten wie natürliche; das Getreidefeld, dessen golden wallenden Haarschmuck der scheinbar freundliche, in Wahrheit tückisch schädliche Glutsommer versengt, aber von den geheimnisvoll schaffenden Erdkräften für das kommende Jahr erneut wird.
Vielleicht entsprechen dieser nordischen Erntegöttin unter andern Namen südgermanische: Frau Waud, Frau Wod (d. h. Frau Wodans, = Frigg = Berahta = Holda), Frau Freke (deutlich Frigg), auch wohl Stempe, Trempe (wegen des stampfenden Fusses, reine pédauque). Pflugschar und Egge, auf denen sie gern im Ackerfeld sich niederlässt, sind ihr geweiht; sie ist unverkennbar eine Schützerin des Ackerbaues, Gewährerin des Erntesegens, eins mit Frigg in dieser Bedeutung der hausfräulichen Göttin, oder sie ist diese eine Seite von Frigg, losgelöst und selbständig personifiziert. Auch wohl Erka, Frau Erke, Frau Herke, Frau Harke heisst sie und führt den Rechen, die Harke, womit die geschnittenen Schwaden zusammengeharkt werden.
Fulla, Friggs Schmuckmädchen (nach dem Merseburger Zauberspruch aber deren Schwester), trägt ein Goldband um die flatternden Locken; sie ist die Göttin der Fülle, der Üppigkeit, des Segens und des Überflusses; romanisch Dame Habonde, Abundia; also auch eine einzelne Seite von Frigg. Sie verwahrt der Herrin Schmuckkästchen und Schuhe und ist ihrer heimlichen Pläne Vertraute.
Auch die Sonne, Frau Sunna, war eine Göttin, welche nicht bloss bei der Lehre von der Entstehung der Welt zur Erklärung des Tagesgestirnes angeführt und damit (für sich allein oder zusammen etwa mit dem Mond) abgefertigt worden wäre, sondern im Volk in allerlei gottesdienstlichen Handlungen verehrt ward und in mancherlei Erzählungen durch die Lande ging.
Während diese Göttinnen unverkennbar in dem Leben des Volks tief wurzelten, machen einige andre Namen, die in der Edda begegnen, mehr oder minder den Eindruck, als seien sie von den Skalden künstlich gestaltet, mit geringem Anhalt an dem Glauben des Volks.
Читать дальше