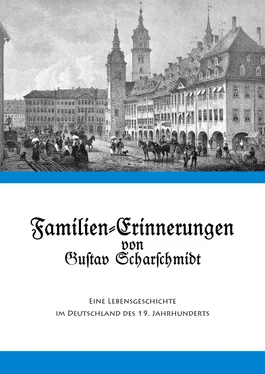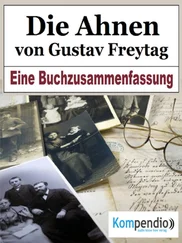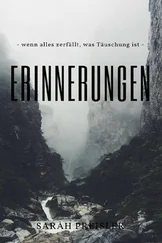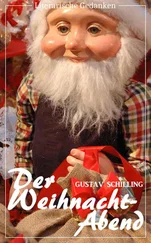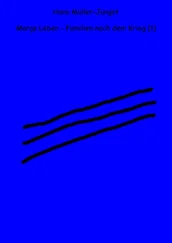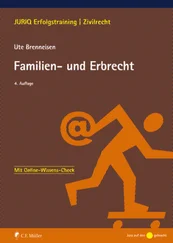Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt
Здесь есть возможность читать онлайн «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In der Klostergasse stand, möglicherweise steht es jetzt noch, ein altertümliches, massig gebautes Haus, das auch Kloster genannt wurde und von dem die Gasse ihren Namen erhalten haben wird. Dasselbe hat jedenfalls mit dem unterirdischen Gang in Verbindung gestanden.
In der Kirche zu Schloss Chemnitz befindet sich die aus einem Eichstamm geschnitzte Geißelung Christi in Überlebensgröße, mit deren Anfertigung sich ein zum Tode verurteilter Verbrecher seine Freiheit erkauft haben soll.
In derselben Kirche wird auch ein angeblicher, nicht weg zu waschender Blutfleck gezeigt, der von einem Mönch herrühren soll, den der Teufel von der Kanzel herabgestürzt hat. Böse Ungläubige, die der Wahrheit nachforschen, finden in dem Blutfleck nur eine dunkle Stelle in der Steinplatte, die einst die Natur hervorgebracht hat und die allerdings nicht wegzuwaschen ist.
Bei einem Aufstand gegen die Bäcker, die die Semmeln zu klein gebacken haben sollten, wurden Läden und Fenster demoliert. Auch ein Aufruhr gegen die Fleischer erhob sich, weil sie Hundefleisch statt Rindfleisch verkauft haben sollen. Die Jahreszahlen sind mir nicht bekannt. (1847, Anm. von Ilse Sonnenschein)
Da es Industriearbeiter in solcher Zahl wie jetzt nicht gab, so können nur die Weber, die die Hauptmasse der gewöhnlichen Bevölkerung ausmachten und Handwerksgesellen die Urheber der Aufstände gewesen sein.
In den Jahren 1846 und 1847 herrschte große Teuerung. Das Brot kostete mehr als noch einmal soviel wie vorher, die Kartoffelkrankheit 1zeigte sich in diesem Jahr zum ersten Male. Die Kartoffelfäulnis begann auf dem Felde und setzte sich im Keller fort. Alle Lebensmittel wurden teuer, Armut und Hunger zogen in die Familien ein. Man befürchtete Unruhen, besonders gegen die reichen Arbeitsherren. Die Revolution des Jahres 1848 stand vor der Tür.
Die Stadtverwaltung errichtete in den Bezirken Speiseanstalten, in denen an Arme Brot und warme Speisen unentgeltlich verabreicht wurden. Die Kartoffelkrankheit hatte jedoch die besten Sorten Kartoffeln, die sogenannten Lerchen und Mäuse, vernichtet. Der Anbau lohnte sich nicht, die Erde brachte sie nicht mehr hervor.
Neben den Webereien und Spinnereien entstanden Maschinenfabriken, das Dorf Schloss Chemnitz wurde der Stadt einverleibt, Chemnitz wurde die größte Fabrikstadt Sachsens und wuchs nach dem Bau der Eisenbahn zu einer Großstadt heran.
Im Jahre 1856 verließ ich meine Vaterstadt, ich habe sie aber von meinen nachmaligen Aufenthaltsorten aus bis in die 1880er Jahre oft und gerne besucht. Die alten Plätze, Gassen und Gässchen der inneren Stadt, die bekannten Gegenden der Vorstädte, die Umwälzungen und Neubauten zogen mich an.
In den Vorstädten fiel manches Gebrechliche und Altertümliche der Neuzeit zum Opfer. Wo man früher durch die Felder stundenlange Spaziergänge machte, waren mächtige neue Städte, an Einwohnerzahl so groß wie das alte Chemnitz, entstanden. Villenviertel und Alleen für die wohlhabenden Bürger, unzählige Häuserquadrate für die arbeitende Bevölkerung.
Von der Armut, von dem Schmutz und der Finsternis der 1830er Jahre war nichts mehr zu sehen.
Mein Vaterhaus
In dem auf der nächsten Seite skizzierten 2, im Jahr 1830 erbauten Chaussee-Einnehmer-Hause in Chemnitz an der Dresdner Straße bin ich und sind alle meine übrigen jüngeren Geschwister geboren, nur meine ältere Schwester ist in der Bretgasse, wo meine Eltern vorher wohnten, zur Welt gekommen.
Das Haus stand am äußersten Ende der Stadt, jedoch innerhalb der Zaun-Umfassung. Es bestand nur aus dem Erdgeschoss und vorn in einem Erker am Dach. Rechts und links war eine Wohnstube, mit je 2 Fenstern nach vorne und einem Fenster an der Giebelseite. An jeder Stube eine Kammer, die linke mit einem, die rechte mit zwei Fenstern. Der Hausflur führte hinten rechts zur Küche, links in den Keller und zur steinernen Treppe. Der Dachraum enthielt eine Erkerstube, an deren beiden Seiten Kammern.
Von der hinteren Flurtür führten 6 Stufen in den Hof, in dem man auf einem gepflasterten Wege rechts nach den Aborten gelangte. Neben diesen waren Holzställe und ein Lattenschuppen, zwischen hier und dem Hause war ein Grasplatz.
Der Hof war von dem Garten durch einen Lattenzaun abgesperrt. Zum Abschluss des Hofraumes von der Straße befand sich vom Haus an nach rechts eine Bretterwand mit Tür. Im Übrigen war die ganze Fläche, den Garten eingeschlossen, mit einem Stangenzaun umgeben.
Links hinter dem Haus im Garten stand eine Pumpe, die erst später auf den Antrag meines Vaters gegraben worden war. Sie enthielt jedoch meist durch zerquetschte Würmer, Frösche, Eidechsen und solches Getier verunreinigtes Wasser. Der Bedarf an reinem Wasser musste immer noch auf einem, im Winter beschwerlichen, Weg aus der städtischen Quetsche, außerhalb des Grundstücks an der Waisenstraße, gedeckt werden.
Der Garten war hinten und seitwärts vom großen Gras und Bleichplatz in Gemüse- und Erdbeerbeete mit Rabatten eingeteilt. Die Rabatten waren mit Buchsbaum eingefasst und mit Blumen, Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern bepflanzt. Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Kirschenbäume standen hier und da, Himbeersträucher am Zaun.
Die Anhöhe unserer Wohnung gegenüber hieß der Sonnenberg, weil die dortigen Grundstücke dem Besitzer des Gasthofs zur Sonne gehörten. Zur Höhe hinauf zog sich der die Stadt umschließende Stangenzaun.
Neben dem großen, quer über der Straße stehenden, dem Wagenverkehr bestimmten Tor, das mit dem Stadtzaun verbunden war, befand sich eine kleine Pforte für die Fußgänger.
Tor und Pforte wurden für die Nacht verschlossen. Von ihnen ging ein Klingelzug nach dem Chausseehause, in dem sich des Nachts ein besonderer Wächter aufhielt, der auf das Klingelzeichen aufzuschließen und die Wagen oder Reisenden einzulassen hatte.
Zu jedem Chausseehaus gehörten Güterbeschauer mit der Verpflichtung, die eingehenden Wagen auf steuerbares Gut zu untersuchen.
Im Jahre 1833 oder 1834 wurden diese Tore beseitigt und dafür Schlagbäume, genannt Barrieren, errichtet. Von dieser Zeit an fiel auch der Zaun um die Stadt.
Der Schlagbaum bestand aus einem langen, grün und weiß angestrichenen Baumstamm, an dem hinten über den Straßengraben am dicken Ende ein mit großen Steinen beschwerter Kasten befestigt war, dessen Gewicht den Baum hinten niederzog. Der Baum ruhte mit dem hinteren Teile in einem Kloben auf einer Säule und bewegte sich an einem starken eisernen Bolzen.
Von der Spitze hing eine Kette herab, die vor dem Hause in einem Seile endigte. Seil und Kette liefen durch eine Säule über eine hölzerne Rolle in das Wohnzimmer des Chausseehauses hinein. Hier stand unter dem Fenster ein Kasten mit einer Welle, um die die Kette mittels eines Drehlings gezogen wurde. Die Säule vor dem Haus endigte oben in einer Gabel, in die sich der zugezogene Schlagbaum mit seiner Spitze hineinlegte.
Abends, gleichzeitig mit Zuziehung des Schlagbaumes, wurde eine große Laterne vor dem Expeditionsfenster, mit einer Rüböllampe versehen, aufgehängt. Sie erleuchtete die Straße.
Die Geschirrführer und Viehtreiber hatten mit der Peitsche zu knallen oder an das Fenster zu klopfen, worauf von innen durch ein kleines Fenster nötigenfalls mittels Klingelbeutels das Chausseegeld erhoben und der Schlagbaum geöffnet wurde. Die Postillone hatten durch Signalblasen Einlass zu begehren.
Das Rasseln der Kette beim Auf- und Zuziehen des Schlagbaums hörte man durch das ganze Haus. Nicht wenig Fußgänger sind trotz der leuchtenden Laterne mit dem Kopf an den geschlossenen Schlagbaum angerannt, besonders bei trübem Wetter. Ein lautes Schimpfwort besänftigte dann den gehabten Schreck.
In allen Chausseehäusern, wie auch in dem meines Vaters, hatte stets die Einrichtung bestanden, dass an die Fuhrleute auf Verlangen ein Gläschen Schnaps verkauft wurde. Dieser kleine Handel wurde nicht als Schankbetrieb aufgefasst und musste auf Anordnung der Behörde eingestellt werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.