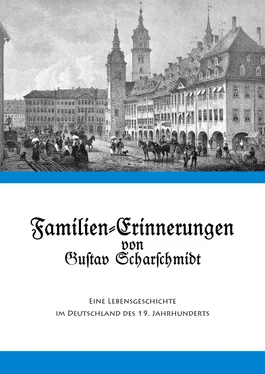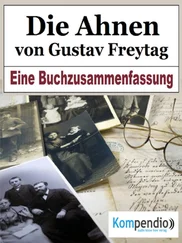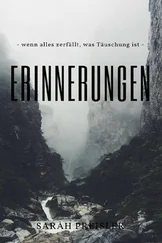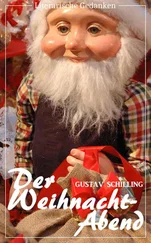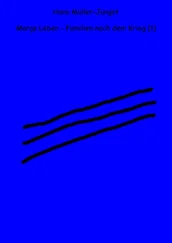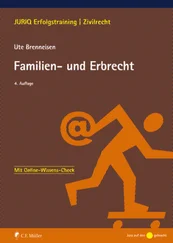Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt
Здесь есть возможность читать онлайн «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Meine ältere Schwester war eines derjenigen Kinder, die in das neue Schulhaus bei der Eröffnung einzogen. Das Gebäude war im Hinblick auf zu erwartende Zunahme der Bevölkerung auf Mehrbedarf berechnet. Es waren wohl kaum die Hälfte der Zimmer von Kindern besetzt.
Besser gestellte Eltern schickten ihre Kinder in die sogenannte lateinische Schule, die sich hinter der Stadtkirche in einem hohen schwarzen Gebäude befand. Dieses Haus war und blieb schwarz, nie ist der Abputz erneuert worden. Auf dasselbe drang das ganze Jahr hindurch nie ein Sonnenstrahl hinter der Kirche hervor. Ernst und düster, diesen Eindruck dürften auch die Schulzimmer gemacht haben. Von hier aus konnten die Schüler eine höhere Schule und die Universität besuchen.
Eine einzige Apotheke, die Adler Apotheke, stand am Hauptmarkt.
Altertümlich und finster waren die Fleischergeschäfte, die nicht etwa am Äußeren des Hauses durch ein Schild kenntlich gemacht waren. Im höchsten Falle wurde ein Teil des geschlachteten Tieres an die Haustüre gehängt. Verkaufsläden gab es nicht.
Wenn man seinen Bedarf an Fleischwaren decken wollte, ging man in den Hausflur des Fleischers, klopfte oder rief; worauf der Meister oder die Meisterin mit einem Küchenlämpchen erschien; dann ging es den langen, finsteren Hausflur hinunter, eine schwarze Türe wurde aufgeschlossen und man betrat einen stockfinsteren Raum ohne Fenster, in dem ein übler Fleischdunst herrschte, jeder Luftzugang war abgeschlossen.
Bei dem matten Schein des Lämpchens erblickte man an den Wänden und auf dem Hackstock einige Würste und Fleischstücke, von denen das Gewünschte abgeschnitten wurde. An Wurst gab es nur Blut- und Leberwurst, selten Bratwurst. Gewiegtes, rohes Fleisch zu essen kannte man damals noch nicht. Nicht zu jeder Zeit waren beim Bäcker oder Fleischer Waren zu bekommen.
Der Stadtrat machte allwöchentlich in der amtlichen Zeitung bekannt, welcher Meister oder Bürger in der laufenden Woche das Backen, das Schlachten, das Brauen hatte. In meiner Schulzeit gab es nur einige Gasthöfe, Schankwirtschaften sind erst später entstanden.
Manche Bürger hatten das Recht, sich in der Stadtbrauerei Bier zum Verkauf brauen zu lassen. Deren Namen wurden, wie oben bemerkt, vom Stadtrat bekannt gemacht. Von ihnen holte man sich seinen Bierbedarf. Das nannte man „Ruheschank“, weil die Bürger der Reihe nach zum Ausschank berechtigt waren.
Dass sie die Erlaubnis zum „Gästesetzen“ hatten, glaube ich nicht. Der Braubürger machte sein Recht dadurch bekannt, dass er an seinem Haus eine Stange mit einem Fässchen an der Spitze anbrachte. Es gab zu jener Zeit nur eine Sorte, also nur einfaches Bier. Schnaps war natürlich auch zu haben, es wird daher in der alten guten Zeit verhältnismäßig ebenso viel „Trinker“ gegeben haben wie jetzt.
Butter und Eier lieferten die Bauersfrauen vom Lande einmal wöchentlich in die Familien, oder verkauften sie an den Markttagen des Sonnabends auf dem Hauptmarkt. Im Winter war kein Ei zu haben, denn das Verfahren der Aufbewahrung von dem Verderben ausgesetzten Lebensmitteln war nicht bekannt. Die Milch wurde von den Viehwirtschaften in der Umgebung herbeigeholt.
Ein Pfund Fleisch kostete 11 Pfennige, kaufte man für 6 Pfennige Wurst, so bekam man ungewogen ein Stück, woran man sich alleine für den ganzen Tag satt essen konnte; eine Kanne Bier, soviel wie ein reichlicher Liter, kostete 6 oder 8 Pfennige; eine Kanne Milch 3 Pfennige; ein Stück Butter, ein Gewicht von reichlich 22 Lot = 344 Gramm, 18 Pfennige, zwei Eier 3 Pfennige.
Ein Tagelöhner erhielt außer der Kost täglich 2 gute Groschen = 24 Pfennige Lohn. Hatte er Familie, so musste die Frau, wenn sie nicht auch Verdienst im Tagelohn fand, mit den Kindern betteln gehen. Scharen von Kindern aus den Städten überschwemmten die Dörfer, sie sangen oder stammelten einen Gesangbuchvers in den Häusern und nahmen die Mildtätigkeit in Anspruch. Diese Landplage wurde erhöht durch die fechtenden Handwerksburschen.
Den Personenverkehr vermittelten nach den größeren Städten die 2- und 4-spännigen Postwagen, die Diligence und Journaliere genannt wurden. Später kamen Lohnkutscher mit großen Personenwagen hinzu, die weit billiger beförderten als die Post. Reiche Leute fuhren Extrapost. Frachtwagen, denen oft 12 und mehr Pferde vorgespannt waren, beförderten die Güter im Lande und ins Ausland.
Der Handelmann mit seiner Last auf dem Rücken, der die Jahrmärkte besuchende Handwerker, der Schiebböcker mit Kirschen, Pflaumen, Preißelbeeren, Pöklingen oder Rußbutter und andere Leute, die eine Reise unternahmen und nicht in der Post fahren konnten oder wollten, sie alle waren auf ihre Füße angewiesen, belebten die Landstraße und machten tagelange Märsche.
An vielen Stellen führten die Straßen durch Hohlwege, die in den Winterhalbjahren schwer zu befahren waren und in denen Wagen und Pferde sitzen blieben und warteten bis nach und nach so viel Pferde angelangt waren, dass es möglich wurde durch vorspanne die Wagen aus dem Morast herauszuziehen.
Für die mittelalterlichen Raubritter mögen allerdings diese Hohlwege von großem Vorteil gewesen sein, denn sie konnten von oben dem Waren führenden Kaufmann bequem auflauern und ihm Hab und Gut durch Überfall abnehmen.
Wurden die Landstraßen schlecht, so beschüttete man lange Strecken mit geschlagenen Steinen. Das zusammenfahren dieser Steine durch eiserne Walzen kannte man nicht. Durch die verkehrenden Wagen wurde die Straße in mehreren Wochen wieder glatt, für die Pferde war es natürlich eine fürchterliche Lästerei.
Die Frachtfuhrleute trugen eine weiß-rote Zipfelmütze, darüber den Zylinderhut; ein blaues Hemd mit roter Stickerei über den Unterkleidern; und über den Leib war die gefüllte Geldkatze geschnallt, an der ein Täschchen mit dem kleinen Gelde sich befand.
In den Gasthöfen wurden diese Leute gut bewirtet, es war Sitte, dass ihnen der ganze Braten in der Pfanne zur beliebigen Verteilung vorgesetzt wurde. Zu einem Frachtwagen gehörten je nach der Bespannung 6 und mehr Fuhrleute.
Die Gastwirte an den Hauptstraßen sind in jener Zeit reiche Leute geworden. Seit die Eisenbahnen den Verkehr der Landstraßen an sich gezogen haben, sind diese Gasthöfe vereinsamt und nur auf den Besuch aus den nächstliegenden Ortschaften angewiesen.
Nicht nur die Lastwagen, sondern auch die Personen und Postwagen hielten fast an jedem Gasthof an, um die Pferde ruhen zu lassen. Dieser Aufenthalt wurde natürlich von den Reisenden benutzt, um den immer quälenden Durst zu löschen. Dass man dabei auch den Postillon nicht so trocken zusehen ließ, das hielt man für angemessen. Er blies dafür bei der Abfahrt und wenn es durch ein Dorf ging ein Stückchen auf seinem Horn. Auf diese Weise war eine Reise mit der Post nicht gar so langweilig. Mit der Zeit wurde ja auch das Fahrgeld bedeutend ermäßigt.
Führte der Weg durch ein Städtchen und das Posthorn schmetterte, so flogen die Fenster auf und junge Mädchen blickten heraus. Man grüßte hinüber und sie dankten freudigst, in den Reisenden einen kurz- oder langjährigen Bekannten vermutend.
Den vierspännigen Hauptpostwagen begleitete ein Schaffner, der die Wertsachen verwahrte und in der vorderen Wagenabteilung, dem Kabriolett, seinen Platz hatte. Der Postillon durfte hier nur an solchen Orten anhalten, wo der Schaffner Briefe abzugeben oder mitzunehmen hatte.
Als ein altes Häuschen an der Südseite des Marktes in Chemnitz abgetragen wurde, fand man unter demselben ein eingemauertes Skelett und einen unterirdischen Gang, der unter der Klostergasse und unter dem Schlossteiche hinweg nach dem Kloster führte, das später mit der Kirche und den Wirtschaftsgebäuden Schloss Chemnitz genannt wurde.
Auch unter anderen alten Gebäuden hat man eingemauerte Skelette gefunden. Nach dem Aberglauben in alter Zeit sollten die mit etwas Lebensmitteln lebendig eingemauerten Menschen nach dem Tode des Eingemauerten das Haus und dessen Bewohner beschützen, ihnen Wohlergehen verschaffen und sie vor drohendem Unglück warnen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.