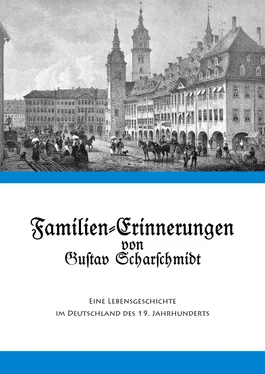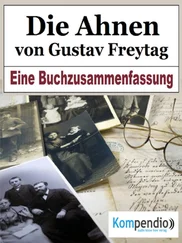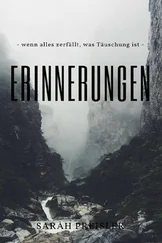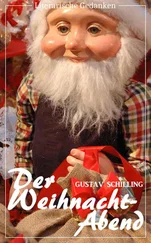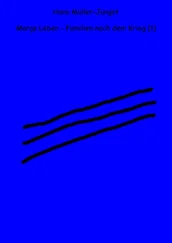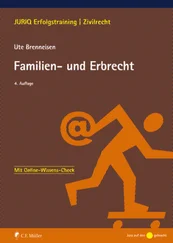Dieses Buch dagegen beinhaltet die Lebenserinnerungen meines Ururgroßvaters, die er im Dezember des Jahres 1900 im Alter von 69 Jahren aufzeichnete. Es sind also keine Tagebuchaufzeichnungen, aber aus meiner Sicht macht gerade diese zurückblickende Betrachtung einen wesentlichen Reiz dieses Erinnerungen aus, denn seine Lebenserfahrung ermöglichte es ihm, die auch uns heute noch bekannten historischen Ereignisse dieser Zeit zu kommentieren und mit seinem Lebenslauf zu verknüpfen.
Neben dem Rückblick auf geschichtsträchtige Begebenheiten schildert das Buch vor allem auch das tägliche Leben und Überleben der Menschen im vorvorigen Jahrhundert, beginnend mit den Vorfahren Gustav Scharschmidts bis zu seinem Lebensabend. Und auch hier wird immer wieder die geschichtliche Entwicklung deutlich und lebendig, z.B. als der Übergang von Kleinstaaten zu einem vereinten Deutschland mit dem Fall der Zollgrenzen sich direkt auf das Leben der Familie Scharschmidt auswirkt.
Vor kurzem fiel mir über meine Eltern das Dokument mit diesen Aufzeichnungen wieder in die Hände. Und da die moderne Technik das Erstellen und Veröffentlichen von Büchern heutzutage so viel einfacher machen, entschied ich mich, es einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen, denn ich glaube, dass viele diese Lebensgeschichte als einen interessanten Einblick in die damalige Zeit sehen werden.
Gerade auch für junge Menschen, für die Bildung, Krankenversicherung, Elektrizität, fließend Wasser, Internet, Handy und vieles mehr heutzutage selbstverständlich scheinen, kann dieses Buch vielleicht ein lesenswertes Fenster in eine frühere Zeit darstellen.
Meine Bearbeitungen dieses Buches beschränken sich auf Formatierungen und Korrekturen von Fehlern, die bei der manuellen Übertragung aus dem Altdeutschen durch meine Großmutter entstanden sind – damals gab es noch keine Computer mit Rechtschreibkorrektur, sondern nur eine einfache Schreibmaschine. Und die mittlerweile wohl fast verlorene Fähigkeit, handgeschriebene deutsche Schrift zu entziffern.
Außerdem habe ich einige der im Text erwähnten historischen Personen und Begebenheiten mit Endnoten versehen, die auf weiterführende Informationen im Internet verweisen, so dass interessierte Leser die entsprechenden Themen vertiefen können.
Ich widme dieses Buch meiner Großmutter Ilse Sonnenschein, geborene Scharschmidt, die das Manuskript bewahrt und für die Nachwelt verfügbar gemacht hat.
Elmar Sonnenschein
Juni 2014

Stadtplan von Chemnitz um 1885
Chemnitz zählte im Jahre 1830 eine Bevölkerung von 12.000 Köpfen. Der Ort hatte noch ziemlich das Aussehen einer mittelalterlichen Festungsstadt. Bis zum Jahr 1845 war der innere Stadtteil von einer starken Mauer mit festen Türmen fast vollständig umgeben und dadurch von den Vorstädten getrennt.
Außerhalb der Mauer befand sich der etwa 20 m breite und 6 m tiefe Wall, oder Stadtgraben, der nur an den Hauptstraßen, sowie nach der Bürgerschule und dem Stadttheater zu, ausgefüllt war.
An einigen Eingängen zur inneren Stadt standen noch die finsteren Warttürme, großenteils jedoch ohne Torflügel, die ich nur noch an dem Tore nach dem Kastberge gesehen habe. Diese Flügel wurden des Abends geschlossen.
Von Wasser angefüllt habe ich den Stadtgraben trotz seiner Tiefe nie gefunden. Nur in der Mitte floss das sich sammelnde Wasser in einer schmalen Vertiefung ab. An manchen Stellen waren von den Besitzern der Nachbargrundstücke Gemüse- und Blumenbeete angelegt, die ihm ein freundliches Aussehen verliehen. Stufen führten dazu hinüber.
Jeder Stadtturm hatte seinen Namen. Der nahestehende war das Chemnitzer Tor und stand am Ausgang zur Annaberger Straße. Die anderen nannte man das Nicolai-Kloster und Johannis-Tor. Nach diesen Benennungen hatten die Teile der äußeren Ringstraße um den Stadtgraben herum ihre Namen, wie der Chemnitzer Nicolai-Kloster und Johannis-Graben erhalten und heißen wohl noch so.
Die Räume in den Türmen wurden zu Gefängnissen verwendet, ein Gefängniswärter wohnte in einem Häuschen außerhalb des Turmes. Das Tor nach dem Kastberge zu hatte keinen Turm.
Die Ausfüllung des Stadtgrabens durch Schutt ging in den 30er und 40er Jahren nur schrittweise vor sich, sie ruhte oft lange Zeit. Erst später, als Privatgebäude in den Graben gebaut wurden, wurde die Zuschüttung eifriger betrieben.
Über den Chemnitzfluß führten hölzerne Brücken, die nach der Zwickauerstraße war mit Wänden und Dach versehen, man nannte sie die „hohle Brücke". Über den Gablenzbach nun, zwischen der inneren Stadt und der Dresdner Straße befand sich eine steinerne Brücke mit einem Bogen, über den man von der einen Seite hinauf und auf der anderen Seite hinunter gelangte. Da die Brücke schmal war und nur ein Fuhrwerk passieren konnte, so mag es oft zwischen den sich begegnenden Geschirren langen Aufenthalt gegeben haben. Dieser Übelstand wurde in der Mitte der 40er Jahre durch einen neuen Straßen- und Brückenbau beseitigt.
Die Vorstädte waren rings von einem Stangenzaun umgeben, der an den Landstraßen mit einem mächtigen Lattentor abschloss. Diese Tore, wie diejenigen, die nach den Feldern Zugang boten, wurden für die Nacht verschlossen. Wächter öffneten auf Verlangen.
In rauer Jahreszeit waren die Straßen der Vorstädte besonders schmutzig, im Winter watete man bis über die Knie im Schnee. Kinder, die frühzeitig zur Schule gingen, mussten sich durch den tiefen Schnee Bahn treten und kamen mit erfrorenen und nassen Beinen am Ziel an. Nur wenige Hausbesitzer reinigten am späten Tage den Fußweg, die unbewohnten Strecken blieben ungebahnt.
Der Schnee blieb liegen bis er im Frühjahr wegtaute. Man kann sich daraus ein Bild machen, in welchem Zustand sich die Straßen bei Tauwetter befanden. Einen milden Winter gab es in meiner Jugendzeit nicht, alle zeichneten sich durch große Kälte und Massenschnee aus. Das wusste man nicht anders.
Zur Straßenbeleuchtung wurde Rüböl verwandt. Die Laternen hingen über der Mitte der Straße an geteerten Seilen und wurden zum Reinigen und Anzünden herunter und hinauf gedreht.
Pflaster gab es nur auf den Straßen der inneren Stadt, es war aber so mangelhaft, dass bei schlechtem Wetter der Schmutz und die Wasserpfützen genügten, wenn man sich gar einmal recht „amüsieren" wollte.
Sogenannte Schulen waren wenige vorhanden. Sie befanden sich in Privatwohnungen und wurden freiwillig und infolgedessen schwach besucht. Wenn ein Kind keinen Sechser erlegen konnte, durfte es nicht am Unterricht teilnehmen. Diesen gaben Privatlehrer, die nebenbei eine Professur betrieben. Die Schulstunden werden wohl meist mit Prügeln der Kinder seitens der Lehrer ausgefüllt worden sein, denn Prügel stand als Erziehungsmittel in hohem Ansehen.
Aber Pestalozzi hatte ein halbes Jahrhundert hindurch nicht umsonst gekämpft und gelitten, seine Lehren brachen sich endlich Bahn. Man erkannte, dass die Bildung des Volkes, zunächst der Kinder, eine Notwendigkeit der Zeit sei und man forderte Bildung.
Überall wurden Volksschulhäuser errichtet, auch Chemnitz begann mit dem Bau einer Bürgerschule, die an Ostern 1831 eröffnet wurde. Sie schien den damaligen Chemnitzer Bürgern ein Riesenbau zu sein und für einige Zeiten auszureichen. Sie steht in der Nähe des wohl um dieselbe Zeit erbauten Stadttheaters und ist gleich wie dieses auf dem zugefüllten Stadtgraben errichtet.
Alle Kinder wurden nun schulpflichtig. Ein Schuldirektor mit dem Namen Pause (sic!), sowie die nötigen Lehrer wurden von der Stadt angestellt und besoldet.
Читать дальше