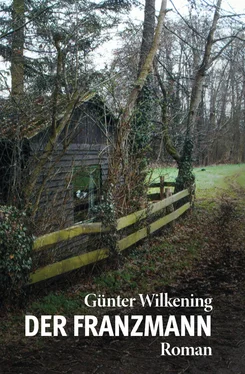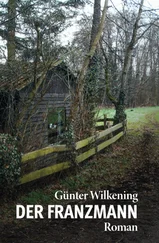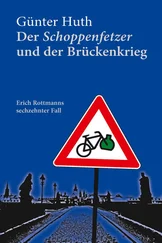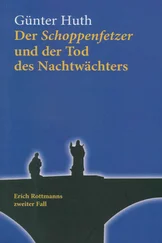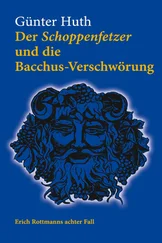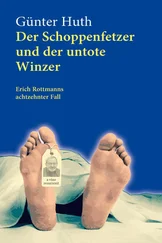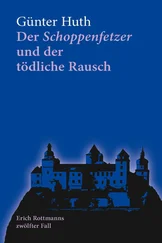Sein Antrag beim Arbeitsamt in Grafenhagen auf Zuteilung zweier Hilfskräfte war vom Landrat und vom Kreisbauernführer befürwortet worden. An sich wäre er selbst als Bürgermeister und Ortsbauernführer seines Dorfes für eine Befürwortung oder Ablehnung zuständig gewesen; da er jedoch in eigener Sache hätte entscheiden müssen, hatte er den Landrat und Kreisbauernführer eingeschaltet, die beide - wie Karl Brammer - der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, angehörten. Seine beiden Parteigenossen hatten den Antrag selbstverständlich befürwortet.
Es war zunächst vorgesehen, die Gefangenen morgens unter Bewachung zum Hof zu bringen und abends wieder abzuholen. Da Karl Brammer die Gefangenen jedoch in dem kleinen Raum im Dachgeschoss seiner Leibzucht unterbringen konnte und da sich der Pole und der Franzose seit ihrer Gefangennahme angepasst verhalten hatten, inzwischen auch gut Deutsch sprachen, hatte der Bauer die Genehmigung bekommen, die beiden bei sich wohnen zu lassen. Für die Entscheidung war insbesondere auch maßgebend gewesen, dass ein Bringen und Abholen der Gefangenen im erheblichen Masse Bewachungspersonal zeitlich gebunden hätte, zumal sie die Wege von und nach Grafenhagen zu Fuß hätten zurücklegen müssen. Nur den Bewachern hätte ein Fahrrad zur Verfügung gestanden.
Beide Gefangenen sollten sich - so war dem Bauern gesagt worden - in der Landwirtschaft auskennen.
Seitens der Landesregierung war bereits einige Zeit zuvor eine vertrauliche Mitteilung an die Landräte, Kreisbauernführer, Bürgermeister, Ortsbauernführer und an die Kreisleitung der NSDAP geschickt worden, wonach die Unterbringung und Ernährung der Kriegsgefangenen so zu erfolgen habe, dass die Gefahr einer Annäherung an deutsche Staatsangehörige möglichst vermieden werde. Eine Annäherung über das unumgängliche Maß hinaus sei unerwünscht. Es sei Aufgabe der angeschriebenen Stellen, auf die Bevölkerung dahin einzuwirken, dass eine größtmögliche Zurückhaltung gegenüber Gefangenen gezeigt werde. Karl Brammer hatte sich vorgenommen, die Anordnung zu beachten.
Der Bauer hatte inzwischen den Bach überquert und seinen Hochsitz am Rande des Feldweges erreicht. Er kontrollierte die Sprossen der Leiter und erinnerte sich dabei, wie er vor Jahren zusammen mit seinem Vater und Fritz Tegtmeier den Hochsitz gebaut hatte, wozu sie Holz aus dem Wald seines Vaters verwandt hatten.
"Meine Güte", dachte er, "ist das schon lange her. Was hat sich seitdem nicht alles ereignet."
Dann schlug er mit dem Hammer zwei Nägel in eine Sprosse, die sich gelöst hatte, stieg anschließend nach oben, von wo aus er die Weide und seine Felder überblicken konnte, setzte sich auf eine schmale Bank auf der Plattform des Hochsitzes und beobachtete zwei Rehe auf seinem Feld. Für einen Augenblick dachte er auch an seinen Sohn, der gern auf den Hochsitz geklettert war, aber vor fünfzehn Jahren im Alter von zehn Jahren an einem Blinddarmdurchbruch gestorben war. Zunächst hatten er, seine Frau und seine Eltern angenommen, dass sich der Junge, als er unter Schmerzen in der Bauchgegend litt, den Magen verdorben habe. Erst als die Schmerzen für das Kind unerträglich geworden waren, hatte Karl Brammer den Hausarzt seiner Mutter benachrichtigt, der das Kind untersucht und danach sofort in seinem Auto zum Krankenhaus in Grafenhagen gebracht hatte. Eine Operation am nächsten Tag hatte den Jungen aber nicht mehr retten können, weil nach Angaben der Ärzte das Blut des Kindes bereits zu sehr vergiftet gewesen war. Karl Brammer und seine Frau hatten Jahre gebraucht, um den Schmerz über den Verlust ihres Sohnes, der als Hoferbe vorgesehen war, einigermaßen zu überwinden. Selbst heute noch nach fünfzehn Jahren litt er, wenn er an sein verstorbenes Kind dachte.
Aber der Bauer verdrängte die Erinnerung an seinen Sohn und genoss die kurze Zeit des Alleinseins an diesem Sonnabendnachmittag. Er war ein bisschen stolz auf sich, dass er mit Hilfe seiner Familie und seiner Mitarbeiter bisher nicht nur seinen Hof ertragreich bewirtschaftet hatte, sondern dass er es auch im Übrigen zu etwas gebracht hatte. Er war Bürgermeister seines etwa neunhundert Einwohner zählenden Dorfes Wöhren, war Ortsgruppenleiter und Ortsbauernführer. Freilich war ihm bewusst, dass er diese Ämter nur bekommen hatte, weil er bereits seit 1934 Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, war. Er war damals als fünfter Einwohner seines Dorfes dieser Partei beigetreten. Inzwischen waren etwa fünfzehn^Einwohner aus Wöhren Parteimitglieder. Selbst der Pastor der Gemeinde gehörte dazu. Karl Brammer war von der überörtlichen Parteiführung für seine Ämter bestimmt worden. Diskussionen darüber hatte es nicht gegeben. Allerdings hatte sich auch kein anderer gefunden, der bereit gewesem war, diese Ämter zu übernehmen, deren Ausübung viel Zeitaufwand erforderte. Karl Brammer dagegen war von vornherein bereit gewesen, der Partei und seinem Dorf zu dienen. Er war aus Überzeugung Nationalsozialist geworden und gehörte seit 1934 auch der SA, der Sturmabteilung, in Grafenhagen an.
Das Programm der Partei vom 24 Februar 1920, verkündet auf einer Massenveranstaltung im Hofbräuhaus in München, hatte er intensiv gelesen. Es hatte ihn überzeugt, und er hatte es für erforderlich gehalten, um aus den politisch chaotischen Zuständen der Weimarer Zeit herauszukommen. Die 25 Punkte dieses Programms hatte er sich vor Eintritt in die Partei zu eigen gemacht, wenngleich er Schwierigkeiten mit der Formulierung gehabt hatte, dass deutscher Staatsbürger nur sein könne, wer Volksgenosse sei, der das aber wiederum nur sein könne, wer deutschen Blutes sei, ohne Rücksicht auf seine Konfession; allerdings könne kein Jude Volksgenosse sein. Diese Formulierung hatte er nicht so richtig verstanden und verstand sie auch heute noch nicht. Aber die Frage, warum kein Jude Volksgenosse und somit kein deutscher Staatsbürger sein könne, hatte er für sich letztlich jedoch unbeantwortet gelassen, obwohl er damals einen freundlichen Juden in Grafenhagen kannte, der dort ein Textilgeschäft betrieb und bei dem er oft gekauft hatte. Dieser Kaufmann, der im Frühjahr 1939 sein Geschäft verkauft hatte und nach Nordamerika ausgewandert war - die Gründe dafür waren Karl Brammer nicht bekannt - war doch deutscher Staatsbürger und hatte sogar im Krieg 1914/18 für Deutschland gekämpft. Er gehörte nur einer anderen Religion an als die meisten Staatsbürger Deutschlands, die in ihrer Mehrheit evangelische oder katholische Christen waren. Warum sollte jener Kaufmann kein Volksgenosse und damit kein deutscher Staatsbürger sein dürfen? Karl Brammer hatte das nicht verstanden. Aber er vertraute dem Führer Adolf Hitler und ging von der Notwendigkeit und Richtigkeit dieser Formulierung aus.
Den Programmpunkt, dass nur dem Staatsbürger das Recht zustehe, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, hielt er für gut, auch die Forderung, dass jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleich ob im Reich, Land oder in der Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden dürfe. Dabei war ihm nicht bewusst geworden, dass nach dem Parteiprogramm kein Jude Volksgenosse, somit kein Staatsbürger sein konnte und damit kein öffentliches Amt bekleiden durfte. Ihm hatte diese Formulierung des Parteiprogramms anfangs zwar etwas Unbehagen bereitet; da er aber außer dem Kaufmann aus Grafenhagen keinen Juden kannte, hatte er sich über die Konsequenzen dieses Programmpunktes keine Gedanken gemacht. Dass er viele Menschen betraf, die Deutsche waren, aber weil sie jüdischen Glaubens waren um ihre Stellung im öffentlichen Dienst und damit um ihre Lebensgrundlage fürchten mussten, kam ihm nicht in den Sinn.
Von Judenverfolgungen, insbesondere in der Nacht zum l0. 11. 1938, hatte er nur im wöchentlich erscheinenden "Generalanzeiger" gelesen. Der Propagandaminister Dr. Josef Goebbels hatte die Ausschreitungen gegen Juden in jener Nacht als Reichskristallnacht bezeichnet. Den Zynismus, der in dieser Formulierung steckte, hatte Karl Brammer nicht erkannt. Er war davon ausgegangen, dass sich der Groll der Bevölkerung in den grossen Städten gegen einzelne jüdische Schieber und Spekulanten gerichtet hatte. Hierfür hatte er ein gewisses Verständnis aufgebracht. Von Tötungen jüdischer Menschen hatte er nichts erfahren. Im Übrigen waren die grossen Städte, in denen die Verfolgungen hauptsächlich stattgefunden haben sollten, weit weg. Das galt besonders für die Reichshauptstadt Berlin, in der er noch nie gewesen war. Selbst nach Hannover, das nur etwa 50 Kilometer von Wöhren entfernt und mit der Bahn gut zu erreichen war, kam er höchstens einmal im Jahr und nur dann, wenn er mit seiner Frau deren Bruder und dessen Familie besuchte. Die Arbeiten auf seinem Hof ließen einen Besuch in Hannover nur selten zu und dann auch nur für einen Tag im Winter. Abgesehen davon fühlte er sich in der Großstadt nicht so recht wohl. Es war ihm dort alles zu eng, die relativ kleine Wohnung seines Schwagers und seiner Schwägerin und die Straßenschluchten.
Читать дальше