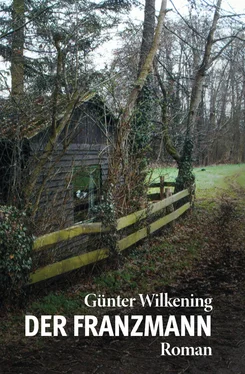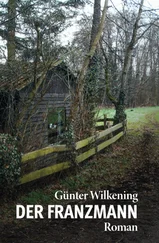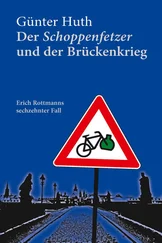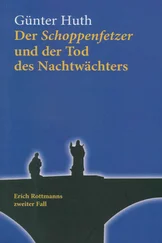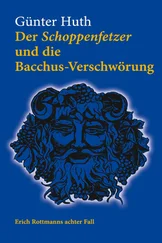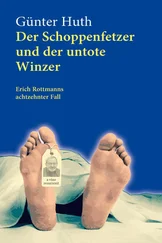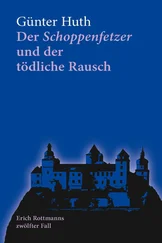An sich hatte er vor, eine Sprosse der Leiter seines Hochsitzes zu reparieren, der etwa in Höhe des Gatters unmittelbar neben dem Feldweg auf seinem Acker stand, der sich bis zum quer verlaufenden Weg erstreckte. Aber er entschloss sich in dem Moment, als er den Weg betrat, zunächst einen kontrollierenden Blick auf seine Jagdhütte zu werfen, die sich in einem Wäldchen jenseits des Baches unmittelbar vor dem quer verlaufenden Weg befand.
Auf der Brücke, die über den Bach führte, blieb er stehen und schaute einen Augenblick dem schnell fließenden Wasser nach. Dann schlenderte er weiter am rechts liegenden Wäldchen entlang, in dem zwei kleine Teiche angelegt waren, und erreichte nach wenigen Minuten die Jagdhütte, die in einer leichten Senke stand und von Büschen und Bäumen umgeben war, so dass sie nicht leicht ausgemacht werden konnte, wenn man sich ihr auf dem Weg, der zu den Hofgebäuden führte, oder dem quer verlaufenden Weg näherte. Jenseits dieses Feldweges lagen weitere Ackerflächen und eingezäunte Weiden, die ebenfalls Karl Brammer gehörten, der den Hof und die Ländereien vor zehn Jahren von seinem verstorbenen Vater geerbt hatte.
Südlich des Wäldchens und der Weide, die er soeben überquert hatte, verlief die Bahnstrecke Berlin, Hannover, Köln. Und wenn Züge auf der Trasse vorbeifuhren, waren die Geräusche sogar in der Wohnung des Bauern selbst bei geschlossenen Fenstern zu hören. Aber in diesen Augenblicken, als Karl Brammer zu seiner Hütte hinüberblickte, näherte sich kein Zug.
Die Jagdhütte, die auf einem Sandsteinsockel stand und im Bereich des Eingangs, der vom Waldboden aus über zwei Treppenstufen zu erreichen war, eine hölzerne, überdachte Terrasse hatte, war von Karl Brammers Vater gebaut worden. Elektrisches Licht gab es in ihr nicht. Bei Dunkelheit mussten sich die Benutzer mit dem schwachen Licht einer Petroleumlampe oder mehrerer Kerzen zufrieden geben. Aber sie war gemütlich eingerichtet. An den Wänden hingen Geweihe und Bilder, die Landschaften und Jagdszenen zeigten, in einem Kamin konnte an kalten Tagen für Wärme gesorgt werden, und die vier Fenster waren von bunten Übergardinen eingerahmt. Vor den Fensterscheiben waren allerdings zum Zwecke einer Verdunklung schwarze Rollos angebracht, und auf den zwei Bänken, die an beiden Seiten vor einem langen Tisch standen, lagen Sitzkissen.
Vor der Hütte, die Unterkunft für etwa zwanzig Personen bot, war eine Feuerstelle gemauert, um die herum drei aus dicken Baumstämmen geschnittene Holzscheiben lagen, die eine Höhe von etwa einen halben Meter und einen Durchmesser von etwa einen Meter hatten und die zum Sitzen und zum Abstellen von Sachen benutzt werden konnten.
Einige Schritte links vom Eingangsbereich der Hütte befand sich ein mit einem etwa einen Meter hohen Steinring versehener Brunnen, aus dem mittels einer Saugpumpe durch Heben und Senken eines Schwengels Wasser in einen kleinen steinernen Trog gepumpt werden konnte. Der Steinring war mit Ausnahme des Pumpenbereichs aus Sicherheitsgründen mit einer runden Steinplatte abgedeckt.
Für Karl Brammers Vater, der in der Nähe der Hütte sogar ein kleines, schmales Häuschen als Plumpsklo hatte aufstellen lassen, war sie ein Refugium gewesen, in das er sich insbesondere nach Jagden mit seinen Kumpanen zum Feiern, oft bis tief in die Nacht hinein, zurückgezogen hatte. Und nicht gerade wenige seiner Jagdgenossen hatten die Hütte anschließend schwankend verlassen und nach dem Eindruck des Bauern Schwierigkeiten gehabt, ihren Weg nach Hause zu finden. Karl Brammer hatte solche Jagdabschlussfeiern wiederholt miterlebt, jedoch nicht so intensiv wie sein Vater, der an der Bewirtschaftung seines Hofes nur mäßiges Interesse gezeigt hatte, aber als Bürgermeister seines Dorfes Wöhren kaum eine Gelegenheit ausgelassen hatte, an Festlichkeiten teilzunehmen und zu besonderen privaten Anlässen, wie zum Beispiel Hochzeiten und hohen Geburtstagen, die Grüße und Glückwünsche der Gemeinde zu überbringen.
Er war ein friedfertiger, hilfsbereiter, fast überall gern
gesehener und sehr geselliger Mann gewesen, der es verstanden hatte, die meisten Bewohner seines Dorfes für sich einzunehmen. Das Kommando auf dem Hof hatte im Wesentlichen seine Frau Sophie geführt, worüber Karl Brammers Vater aber im Grunde froh gewesen war. Er hatte gewusst, dass die Leitung des Hofes bei seiner Frau in guten Händen lag, hatte er doch deshalb beruhigt seinen vermeintlichen Pflichten als Bürgermeister nachgehen können.
Dann hatte ihn eine Krankheit befallen, die von seinem Hausarzt nicht hatte erklärt werden können. Er war abgemagert, hatte sich erschöpft gefühlt, hatte unerträgliche Schmerzen in der Magengegend bekommen, die durch Morphium etwas hatten gelindert werden können, und war schließlich nach etwa sechs Monaten Krankheit gestorben. Wahrscheinlich hatte er Krebs gehabt, der aber in dem kleinen Krankenhaus der in der Nähe gelegenen Stadt Grafenhagen nicht als solcher erkannt worden war. Genaues wusste der Bauer jedoch nicht über die Krankheit seines Vaters.
Der inzwischen 48 Jahre alte Karl Brammer, der sich in den Augenblicken, als er über eine kurze Treppe langsam zu seiner Hütte hinabstieg und sie von außen in Augenschein nahm, an all diese Begebenheiten erinnerte, hatte von seinem Vater das friedfertige und ausgeglichene Wesen geerbt, von seiner Mutter aber ihre Gründlichkeit, ihr Durchsetzungsvermögen und ihre Begeisterungsfähigkeit für etwas Neues und für das Moderne. Sie mischte sich trotz ihrer 75 Jahre jetzt noch gelegentlich energisch in die Belange des Hofes ein, wenn sie es für erforderlich hielt. Die Tatsache, dass ihr Sohn längst Eigentümer des Hofes war, störte sie dabei nicht. Allerdings war sie wegen ihres Alters und ihres offenen linken Beins, das sie deshalb etwas nachzog, nicht mehr in der Lage, auf dem Feld mitzuarbeiten oder schwere Arbeiten im Stall zu verrichten. Sie tat sich aber in der Küche nützlich, indem sie für den großen Haushalt Kartoffeln schälte, gelegentlich kochte und backte und - was sie für wichtig hielt - Papier, insbesondere Tüten und den wöchentlich erscheinenden "Generalanzeiger", für die Benutzer des im Stall gelegenen Plumpsklos in kleine Stücke schnitt.
Im Haus hatte sie neben der großen Diele ein schlicht eingerichtetes Wohn-Schlafzimmer, hielt sich aber tagsüber fast nur in der großräumigen Gemeinschaftsküche des Hauses auf und zu besonderen Anlässen, wie an den hohen Feiertragen und bei Verwandtenbesuchen im Wohnzimmer ihres Sohnes und seiner Familie. Nur an solchen Tagen wurde das Wohnzimmer bei Kälte mittels eines Ofens beheizt. Es dauerte jedoch jeweils Stunden, bis es einigermaßen warm und gemütlich war. In der Küche dagegen brannte im großen Herd wegen des häufigen Kochens bis zum späten Abend ein Feuer, das oft selbst am nächsten Morgen noch glühte. Dieser große Raum war deshalb an kühlen und kalten Tagen am gemütlichsten. Hier fühlte sie sich wohl.
Wenn sie allerdings von Bewohnern des Dorfes oder der Nachbardörfer aufgesucht wurde, die gegen irgendwelche Schmerzen oder Verspannungen im Rücken von ihr geschröpft werden wollten, ging sie mit ihren Patienten in ihr eigenes Zimmer und setzte hier die Schröpfköpfe, die einer kleinen metallenen Glocke ohne Schlägel ähnelten und in die ein kleines brennendes Stück Papier gelegt und sodann auf die Haut der Patienten gedrückt wurden, wo sich der Kopf, der durch das brennende Stück Papier darin luftleer gemacht wurde, festsaugte. Nach einigen Minuten wurden die Schröpfköpfe entfernt und wurde die angesaugte, blutunterlaufende Haut mit einem mehrschneidigen kleinen Gerät eingeschnitten, so dass dunkelrotes, dickes Blut aus den Schnittstellen quoll. Sophie Brammer hatte im Dorf einen guten Ruf als Schröpferin, und ihre Patienten, von denen einige sogar aus Grafenhagen kamen, spürten anschließend angeblich Erleichterung. Über mangelnde Besuche brauchte sie sich deshalb nicht zu beklagen. An manchen Tagen führte sie bis zu fünf Behandlungen durch.
Читать дальше