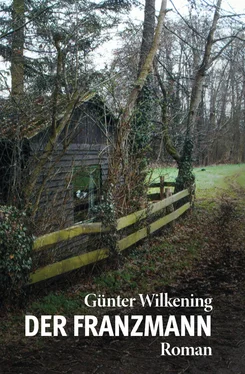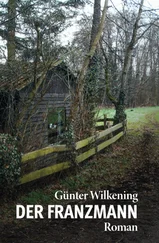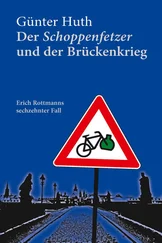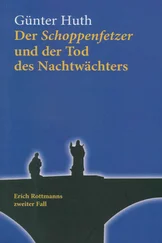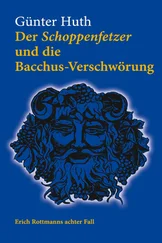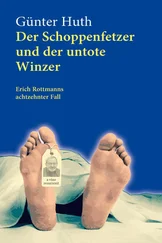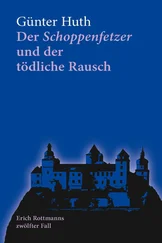Ihre Mutter, der das nicht entging, die jedoch mit niemandem darüber sprach, deutete den Zustand ihrer Tochter dahin, dass jene sich Sorgen um ihren Mann machte und inzwischen viel zu lange von ihm getrennt war. Für eine junge, verheiratete Frau musste es nach Auffassung von Annas Mutter fast unerträglich sein, so lange allein zu leben. Lina Brammer hatte sich schon mal vorzustellen versucht, wie wohl ihre eigene seelische Verfassung gewesen wäre, wenn sie im Alter ihrer Tochter so lange von ihrem Karl hätte getrennt leben müssen. Wahrscheinlich - so glaubte sie - hätte sie das nicht ertragen und wäre trübsinnig geworden. Sie hatte deshalb Verständnis dafür, dass Anna ernst und verschlossen war. Aber sie vermied es, sie darauf anzusprechen.
Anna spürte, dass Baptiste ihre Nähe suchte. Sie ging ihm jedoch, soweit das möglich war, aus dem Weg, aus Furcht vor einer sich steigernden Empfindung für ihn, die sie möglicherweise irgendwann nicht mehr würde steuern können. Auch versuchte sie, besonders bei den Mahlzeiten, seinen Blicken auszuweichen. Andererseits fühlte sie sich mehr und mehr zu ihm hingezogen, was ihr immer bewusster wurde und in ihr tiefe Gewissenskonflikte hervorriefen. Sie flüchtete abends in die Einsamkeit, die sie dann regelmäßig in ihrem Wohnzimmer suchte, und sie fürchtete voller Verzweiflung, dass sie ihrer Sehnsucht nach Baptiste eines Tages nachgeben würde, trotz ihres inneren Sträubens gegen ihre Gefühle für ihn. Sie verstand das alles nicht. Was war nur mit ihr geschehen? Nie zuvor hatte sie so etwas erlebt. Als sie ihren Mann kennen gelernt hatte und sie Wochen danach ein Paar geworden waren, war alles innerlich unkompliziert gewesen. Sie hatten sich amüsiert, hatten Tanzveranstaltungen besucht, waren hin und wieder ins Kino gegangen und hatten abends auf Bänken sitzend oder unter Bäumen stehend geschmust. Erst als sie sich einig gewesen waren, dass sie zusammen bleiben wollten, hatte sie Helmut ihren Eltern und ihrer Großmutter vorgestellt und hatte jener sie zu seinen Eltern mitgenommen. Sicher, sie hatten sich geliebt, aber ihre Gefühle für einander hatten beide kaum wörtlich zum Ausdruck gebracht, wie sie sich zu erinnern glaubte. Dafür hatte aber auch keine Veranlassung bestanden, weil sie sich während der Woche mindestens zweimal und dazu am Wochenende getroffen hatten. Schon mit diesen regelmäßigen Treffen hatten sie ihre Liebe zueinander gezeigt. Besonderer Worte darüber hatte es deshalb nicht mehr bedurft, und unbefriedigte sexuelle Spannungen hatte es für sie kaum gegeben. Alles war zwischen ihnen fast sachlich abgelaufen.
Als Helmut im September 1939 zum Militär eingezogen worden war und seine Grundausbildung in Hannover hatte machen müssen, waren sie etwa alle zwei Wochen dort oder in Wöhren für einige Stunden zusammen gewesen. Aber Anna hatte sich trotz dieser Trennungen von ihrem damaligen Verlobten ruhig und ausgeglichen gefühlt. Selbst als Helmut nach Ostpreußen versetzt worden war, hatte sich an ihrem inneren Zustand kaum etwas geändert. Jetzt aber waren für sie Empfindungen entstanden, die ihr fremd waren, die sie beunruhigten, die ihr Angst machten und die sie nach dem Abendessen in das Alleinsein flüchten ließen. Was war seit dem Erscheinen von Baptiste in ihr vorgegangen? Diese Frage stellte sie sich immer wieder. Aber eine Antwort darauf versuchte sie sich erst gar nicht ernsthaft zu geben, weil sie Angst davor hatte, obwohl sie irgendwie ahnte, dass sie sich in Baptiste verliebt hatte. Und sie war überzeugt, dass Baptiste das gleiche für sie empfand wie sie für ihn.
Baptiste entging natürlich nicht, dass Anna ihm aus dem Weg zu gehen versuchte, dass sie seinen Bemühungen, besonders bei den Mahlzeiten, Blickkontakte mit ihr zu bekommen, auswich. Aber er spürte, dass dieses Verhalten nicht auf einer Gleichgültigkeit ihm gegenüber beruhte oder gar auf einer Abneigung, sondern dass eine Verunsicherung und eine Flucht vor ihren eigenen Empfindungen für ihn die Ursache ihres Ausweichens war. Baptiste selbst hatte in den vergangenen Wochen immer tiefere Gefühle für Anna empfunden. Ihm war längst klar, dass er sich in sie verliebt hatte. Auch er dachte, wenn er allein war, so häufig an sie, dass ihm dabei Angst wurde. Aber er wusste, dass es eine Verbindung zwischen ihnen nicht geben durfte, weil er Kriegsgefangener und Anna verheiratet war. Ihm war klar, dass er den Hof Brammer sofort würde verlassen müssen, wenn auch nur der leiseste Verdacht aufkommen würde, dass er Anna zugeneigt war. Vielleicht würde mit ihm sogar etwas Schlimmeres passieren. Alle diese Gedanken daran, die ihm täglich durch den Kopf gingen, quälten ihn, ließen ihn unruhig schlafen und führten dazu, dass er häufig ernst und traurig wirkte.
Fritz Tegtmeier blieb das nicht verborgen. Er fragte Baptiste deshalb eines Tages: " Wa wa was ist ei ei eigentlich mit dir lo lo los, Ba Ba Baptiste? Du la la lachst kaum noch und bi bi bist o o oft wie gei gei geistesab ab abwesend. Ha ha hast du Ku Ku Kummer? De de denkst du an Zu Zuhau hau hause?"
"Manchmal schon," gab Baptiste zur Antwort und fügte dann in seinem französischen Akzent hinzu: "Es wird schon wieder besser werden. Ganz sicher, ja, ganz sicher."
Fritz gab sich mit dieser Antwort zufrieden, erklärte aber noch tröstend: "Der Krie Krie Krieg wird nicht e e ewig dau dau dauern. Er ist scho scho schon fast zu E E Ende. Eines Ta Ta Tages wirst du nach Fran Fran Frankreich zu zu zurückkeh kehren dü dürfen. Vie vie vielleicht schon ba ba bald."
"Ja, Fritz, vielleicht. Vielleicht schon bald," antwortete Baptiste nachdenklich. Er wollte noch hinzufugen, dass er es hoffe und dass er sich darauf freue. Aber er unterließ es, weil es eine Lüge gewesen wäre, jedenfalls im Augenblick, da eine Rückkehr nach Frankreich eine Trennung von Anna bedeutet hätte.
"Die AA Arbeit ist dir do do doch nicht zu schwer? O O Oder?" wollte Fritz Tegtmeier noch wissen. Ihm war bekannt, dass jener vor seiner Einberufung zum Militär Lehrer gewesen war und deshalb - so vermutete Fritz - die zum Teil schwere Arbeit auf dem Hof für ihn ungewohnt war.
"Nein, nein, sie macht mir sogar Spaß. Ich hätte das vor dem Krieg nicht geglaubt," versicherte Baptiste. Dabei wusste er aber, dass hauptsächlich Anna der Grund für seine Freude an der Arbeit war. Wenngleich er nur ganz selten mit ihr zusammen etwas auf dem Hof verrichten musste, so war sie doch in seiner Nähe und sah er sie während des Tages häufig, nicht nur bei den Mahlzeiten. Diese Tatsache ließ ihn die Arbeit leicht erscheinen und führte dazu, dass er schon abends den neuen Tag herbeisehnte.
Einige Tage nach diesem kurzen Gespräch zwischen Fritz Tegtmeier und Baptiste war der 20. April 1941, der 52. Geburtstag des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler. Alle Häuser in Wöhren waren an diesem Tage mit einer Hakenkreuzfahne beflaggt. Karl Brammer hatte schon vor Jahren einige Meter rechts vom Tor zur Diele ein Loch in den Boden gegraben und darin senkrecht ein gut ein Meter langes, etwa armdickes Metallrohr gesteckt, in das er seinen etwa vier Meter langen, selbst gezimmerten hölzerner Fahnenmast senken konnte, an dem unten und oben je eine Rolle angebracht war, über die eine Leine gespannt war. An dieser Leine konnte die Fahne befestigt und hochgezogen werden. Den Mast mit der Fahne stellte Karl Brammer aber nicht nur am Führergeburtstag auf, sondern an allen nationalsozialistischen Gedenktagen, an denen die öffentlichen Gebäude beflaggt werden mussten. Karl Brammers Hofgebäude gehörte zwar nicht dazu, obwohl er Bürgermeister, Ortsgruppenleiter und Ortsbauernführer von Wöhren war; aber als überzeugter Nationalsozialist wollte er auch an solchen Tagen die Hakenkreuzfahne hissen.
Am Führergeburtstag war es zwar nicht unbedingt Pflicht, die Fahne an den Häusern anzubringen; aber die nationalsozialistische Parteiführung erwartete von allen Hauseigentümern die Beflaggung ihrer Gebäude an diesem Tag, um damit ihre Liebe zum Führer und ihre Zustimmung zu seiner Politik zum Ausdruck zu bringen. Allerdings beflaggte nicht jeder Eigentümer sein Haus aus diesem Gefühl heraus. Das wusste auch Karl Brammer. Ihm war klar, dass mehrere Hauseigentümer im Dorf die Fahne nur deshalb zeigten, weil sie keinen Ärger mit den Nationalsozialisten haben wollten, weil sie die möglichen unangenehmen Fragen der linientreuen Parteileute fürchteten, warum sie ihr Haus denn nicht beflaggten, ob sie etwa etwas gegen den Führer und sein^ Politik hätten. Um solchen Fragen von vornherein aus dem Weg zu gehen oder gar Repressalien jedweder Art seitens der Parteiführung zu vermeiden, hängten diese Leute gegen ihre Überzeugung lieber gleich die Fahne heraus, die sie sich schon alsbald nach der sogenannten Machtergreifung durch die Nationalsozialisten auf Grund ihrer Propaganda, die keinen Widerspruch duldete, angeschafft hatten.
Читать дальше