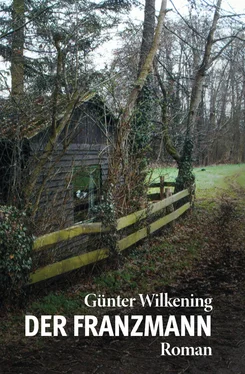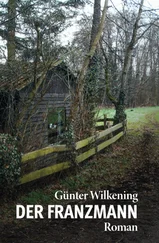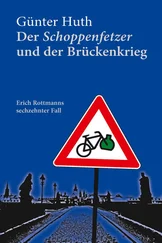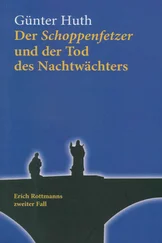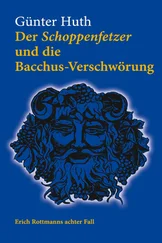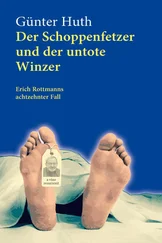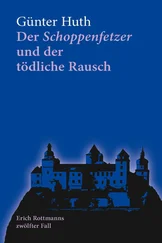Ihr Mann blickte wieder auf und fragte: "Was steht denn da?"
"Das Sondergericht Abteilung I für den Oberlandesgerichtsbezirk Celle beim Landgericht in Hannover," las Lina Brammer vor, "hat eine 37 Jahre alte Witwe wegen Vergehens gegen § 4 der Wehrkraftschutzverordnung zu sechs Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt."
"Was hat die denn getan?" wollte ihr Mann wissen.
"Sie soll sich mit einem französischen Kriegsgefangenen am Kanal getroffen und ihm Äpfel und Zigaretten geschenkt haben. Auch soll sie ihm einen Liebesbrief geschrieben haben. Was in dem Brief stand, steht hier jedoch nicht. Der Gefangene soll bei einem Bauern beschäftigt gewesen sein, der neben dem Haus der Witwe seinen Hof hat. Die Witwe soll mit dem Franzosen über den Zaun ins Gespräch gekommen sein. So sollen sie sich kennen gelernt haben," gab Lina Brammer an und blickte dabei auf die Zeitung.
Dann schwieg sie einen Moment, las weiter und fuhr danach fort: "Der Landgerichtsdirektor Dr. Stein, der Vorsitzende des Sondergerichts, soll das Verhalten der Witwe als beschämend würdelos bezeichnet haben. Was mit dem Franzosen passiert ist, steht hier nicht."
"Haben die beiden denn Geschlechtsverkehr miteinander gehabt?" erkundigte sich Karl Brammer.
"Darüber wird hier nichts gesagt," gab seine Frau an. "Dann kann man ja wohl davon ausgehen, dass es nicht so war."
"Ja, ja," meinte Karl Brammer, "aber trotzdem, so etwas gehört sich nicht, und außerdem ist es verboten."
"Was steht denn in diesem § 4?" fragte Lina Brammer, "weißt du das?"
"Genau nicht", gab ihr Mann zur Antwort, "aber so viel weiß ich, dass ein näherer Kontakt zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Fremdarbeitern verhindern werden soll, also kein freundschaftlicher Kontakt und schon gar kein sexueller zwischen einer deutschen Frau und einem Kriegsgefangenen oder einem Fremdarbeiter, und zwar aus militärischen Sicherheitsgründen. Kriegsgefangene bleiben auch in Gefangenschaft unsere Feinde."
"Kann die Witwe denn gegen das Urteil angehen?" fragte Lina Brammer. "Ich meine, dass sechs Monate Gefängnis ohne Bewährung zu viel sind."
"Nein, gegen die Entscheidung des Sondergerichts kann nichts unternommen werden," belehrte Karl Brammer seine Frau, "und das finde ich auch gut so."
"Ich weiß nicht, Karl," brachte Lina Brammer nachdenklich ihre Zweifel zum Ausdruck, "nur weil sich die Witwe in einen französischen Kriegsgefangenen verliebt hat, ohne dass sexuelle Kontakte bestanden, gleich sechs Monate Gefängnis?"
"Aber das Gesetz ist nun mal so streng," meinte ihr Mann, "wenn es nicht so wäre, würde den Kontakten zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen oder Fremdarbeitern Tür und Tor geöffnet."
"Aber Karl, durch Gesetze kann man doch keine Gefühle verhindern. Es kann doch sein, dass sich eine deutsche Frau in einen Gefangenen verliebt. Ist das so unvorstellbar? Was soll denn daran beschämend würdelos sein, wie sich der Landgerichtsdirektor Dr. Stein ausgedrückt haben soll?"
"Aber es darf nicht sein," gab Karl Brammer zur Antwort, ohne auf die moralische Bewertung des Falles durch den Landgerichtsdirektor einzugehen, "dann muss die Frau ihre Gefühle eben unterdrücken und Kontakte mit dem Gefangenen vermeiden."
"Soll das eine Lösung sein? Nein, nein, ganz so einfach ist es nicht. Gefühle kann man nicht so ohne weiteres beiseite schieben. Stell dir mal vor, du wärest Franzose gewesen, als wir uns kennerlernten. Hätten wir unsere Liebe damals unterdrückt, wenn sie nach einem Gesetz verboten gewesen wäre? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht," versuchte Lina Brammer ihren Mann von ihrer Auffassung zu überzeugen, "selbst dann nicht, wenn uns bewusst gewesen wäre, dass wir hätten bestraft werden können, wenn unsere Beziehung bekannt werden würde. Das Entstehen einer Zuneigung oder gar einer Liebe ist unabhängig von der Nationalität des anderen. Sie kann sich auch dann entwickeln, wenn so etwas verboten ist."
Karl Brammer wusste nicht so recht, was er auf die Argumentation seiner Frau erwidern sollte. Im Grunde gab er ihr Recht. Aber andererseits befand sich Deutschland im Krieg. Und deshalb befürwortete er eine Bestrafung derjenigen Deutschen, die über einen unvermeidbaren Umfang hinaus Kontakte mit Kriegsgefangenen oder Fremdarbeitern unterhielten.
"Es mag ja so sein, wie du sagst," reagierte er etwas hilflos auf die Äußerungen seiner Frau, "aber vergiss nicht, dass Krieg ist, und solange das der Fall ist, gelten besondere Gesetze, die zu beachten sind."
Karl Brammer fühlte sich bei dieser Erklärung nicht ganz wohl in seiner Haut. Er spürte, dass sie nicht ausreichte, seine Frau von ihrer verständnisvollen Einstellung abzubringen. Er war deshalb froh, dass sie zu dem Fall der Witwe nichts weiter sagte.
Beide Eheleute lasen noch eine Zeit lang im „Generalanzeiger“ und gingen dann erschöpft von ihrer Arbeit während des Tages zu Bett.
Seit etwa Mitte März hatten Karl Brammer und sein Knecht auf den zum Hof gehörenden Feldern viel zu tun gehabt. Auch jetzt, Anfang April, war die Bestellung der Felder noch nicht ganz abgeschlossen. Dazu mussten die Äcker der zehn Tagelöhnerinnen gepflügt und geeggt werden. Deren Felder waren zwar nicht allzu groß, meistens handelte es sich nur um einen viertel oder einen halben Morgen, aber einige davon lagen mehrere hundert Meter vom Hof entfernt, drei sogar am Stadtrand von Grafenhagen. Um zu diesen Äckern einen Pflug und zwei Eggen zu transportieren, musste Karl Brammer oder sein Knecht einen Kastenwagen benutzen, vor dem dann zwei Pferde gespannt waren. Die Arbeiten auf den Feldern der Tagelöhnerinnen waren deshalb wegen der Anfahrten ziemlich zeitaufwendig. Aber sie waren fast ebenso wichtig wie die auf den eigenen Feldern des Bauern; denn die Tagelöhnerinnen wurden im Sommer zu den Erntezeiten und im Herbst zum Dreschen des Getreides in der großen Scheune oder auf der Diele dringend benötigt. Auf sie konnte kein Bauer verzichten. Andererseits waren aber auch die Tagelöhnerinnen - ihre Männer waren in der Regel während des Tages berufstätig oder waren Soldat - auf die Bauern angewiesen, da sie allein kaum in der Lage waren, ihre Felder, die sie zur Eigenversorgung und zur Fütterung ihres meist geringen Viehbestandes benötigten, mit dem Spaten umzugraben und dann zu bepflanzen oder zu besäen, zumal sie in der Regel auch noch ihren Haushalt und Kinder zu versorgen hatten und Gartenland besaßen, das sie mit eigenen Gerätschaften durch Handarbeit bestellen mussten. So ergänzten sich beide. Der Bauer half den Tagelöhnerinnen, indem er ihre Felder pflügte und eggte und im Sommer deren Getreide zur Dreschmaschine und das gedroschene Stroh und das Korn zum Haus der Tagelöhnerinnen fuhr, und jene halfen dem Bauern, indem sie ihm tageweise bei der Getreideernte, bei der Kartoffelernte oder beim Dreschen des Korns im Herbst als Arbeitskraft zur Verfügung standen. Die Heuernte schaffte Karl Brammer mit seinen Familienangehörigen und den Eheleuten Tagtmeier in der Regel ohne Mithilfe der Tagelöhnerinnen.
Der polnische Kriegsgefangene Adam Bujak, der inzwischen von allen auf dem Hof nur Adam genannt wurde, kam mit dem ihm zugewiesenen Arbeiten bestens zurecht. Er war kräftig und hatte körperlich keine Schwierigkeiten, sie auszuführen. Selbst zum Melken konnte er herangezogen werden. Er war auch willig und verrichtete manchmal sogar von sich aus Arbeiten, die ihm gar nicht aufgegeben waren, die er aber als notwendig erkannte. Karl Brammer und Fritz Tegtmeier beobachteten seinen Einsatz mit Zufriedenheit.
Adam machte schon am zweiten Sonntag nach dem Beginn seiner Arbeit bei Karl Brammer die Bekanntschaft einer temperamentvollen "Zivilarbeiterin polnischen Volkstums" wie solche Arbeiterinnen offiziell bezeichnet wurden. Sie war auf dem Nachbarhof beschäftigt, hieß Katja Kulik, war 21 Jahre alt, recht ansehnlich und stammte aus der Gegend von Krakau. Adam sah sie an diesem sonnigen Sonntagnachmittag zum ersten Mal, als er gelangweilt vor der Hofeinfahrt stand und auf etwas Interessantes wartete. In der Hoffnung, dass jemand vorbeigehen oder vorbeifahren würde, blickte er nach rechts und links die Straße entlang. Aber es kam niemand. Die Straße blieb menschenleer.
Читать дальше