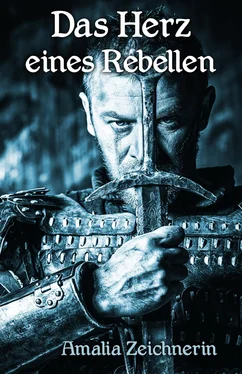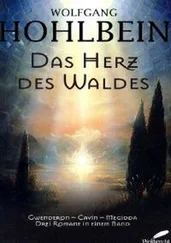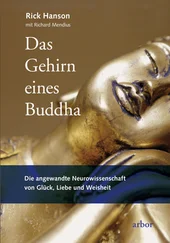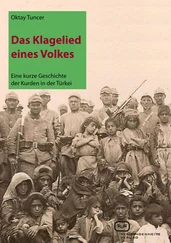Seine Gedanken rasten. Wenn die Regierung nun ihrerseits Leute aus dem Widerstand versklavte, schaffte sie diese nicht nur aus dem Weg, weg von den Kriegsschauplätzen, sondern erzielte damit für sich einen praktischen Nutzen, weil sie auf diese Weise den Adligen und wohlhabenden Bürgern kostenlose Arbeitskräfte zur Verfügung stellte. Die Übelkeit in seinem Inneren nahm zu. Zugleich ergriff ohnmächtige Wut von ihm Besitz, sodass er unwillkürlich die Fäuste ballte.
Eine junge Frau begann leise, fast lautlos, zu weinen. Der Mann neben ihr nahm sie in den Arm. „Noch sind die Würfel nicht gefallen”, sagte er zu ihr. „Sie, deren Name nicht genannt werden soll, wird uns beschützen.”
Die Schicksalsgöttin. Nach alten Überlieferungen brachte es Unglück, ihren Namen auszusprechen.
Severin redete mit dem Gefangenen, der sich neben ihm niedergelassen hatte, ein hagerer, sehniger Mann mit einer rötlichen Narbe am Arm. Lucius lauschte der Unterhaltung.
„Warum wart ihr im Kerker?”
„Kann ich nicht sagen. Besser, ihr wisst es nicht.”
Severin flüsterte dem Mann etwas ins Ohr, und dieser antwortete ihm auf dieselbe Weise.
„Seid ihr auch gefoltert worden?”, fragte Severin danach in gewöhnlicher Lautstärke
„Ja, aber ich hab das schweigend über mich ergehen lassen.”
Severin nickte ihm zu.
„Wisst ihr, wohin diese Straße führt?”, erkundigte sich Lucius bei dem Fremden.
„Nach Serdicia, wenn mich nicht alles täuscht. Von Zeit zu Zeit gibt es dort tatsächlich einen Sklavenmarkt, der wird in der Halle abgehalten, in der sonst das Vieh verkauft wird. Habe ich jedenfalls gehört.”
Lucius runzelte die Stirn. Bei allem, was ihm heilig war, das waren verdammt düstere Aussichten …
Severin nickte dem Mann zu, sagte aber nichts.
Ein hochgewachsener Mann untersuchte unauffällig das Schloss an der Tür ihres fahrenden Gefängnisses, obwohl seine Handgelenke gefesselt waren. „Das hat keinen Zweck”, sagte er nach kurzer Zeit mit niedergeschlagener Miene.
Lucius sah zur Tür hinüber, die mit einer massiven Eisenkette zugesperrt war. Kein Ausweg. Aber vielleicht konnten Severin und er fliehen, wenn sie in Serdicia angekommen waren?
Seltsam, mit welcher Selbstverständlichkeit er nicht nur an sich, sondern auch seinen Leidensgenossen dachte, obwohl er diesen erst wenige Tage kannte. Aber warum auch nicht? Sie hatten schließlich ihre Lebensgeschichten ausgetauscht, waren einander nicht mehr fremd. Außerdem gehörte Severin ebenfalls zum Widerstand, was ihn im Grunde zu seinem Waffenbruder machte.
Noch immer blinzelte er angesichts des Sonnenlichtes, das nun an Stärke gewann und direkt in den vergitterten Wagen schien. Singvögel zwitscherten in den Bäumen an beiden Seiten der Straße, darunter hohe Zypressen. Der Fahrtwind war wie eine frische Brise. Es kam ihm vor, als ob das heitere, milde Wetter und der muntere Gesang der Vögel ihn verhöhnten.
Immer weiter fuhr das Gefährt über die unebene Straße. Manche der Gefangenen unterhielten sich leise, während die Frau, die vorhin geweint hatte, nun apathisch in die Ferne starrte.
Bis auf den hageren Mann, der mit Severin gesprochen hatte, und noch ein, zwei weitere Gefangene sahen diese Leute im Wagen nicht wie Krieger aus. Weder trugen sie Narben noch andere Hinweise auf alte Verletzungen, allerdings hatten einige blaue Flecken. Aber die waren vermutlich durch die grobe Behandlung der Gefängniswärter entstanden. Die Gefangenen waren auch nicht gerade muskulös, wirkten kaum durchtrainiert. Ein schon etwas älterer Mann war eher rundlich, ein anderer schlaksig, beinahe dürr.
Lucius war nicht nach einer Unterhaltung zumute, denn die Übelkeit in seinem Inneren verstärkte sich noch durch das Rumpeln des Wagens. Er hielt sich den Magen, hoffte, sich nicht in der Enge zwischen all den Leuten übergeben zu müssen.
Severin schwieg ebenfalls, seine gewittergrauen Augen wirkten dunkler als sonst.
Die Sonne erreichte den Zenit und es wurde recht warm. Oder vielleicht lag es einfach daran, dass sie dichtgedrängt in diesem Wagen ausharren mussten? Er hatte Durst, doch bei dem bloßen Gedanken, etwas zu trinken, steigerte sich seine Übelkeit. Aber es spielte keine Rolle, denn sie hatten ohnehin kein Wasser im Wagen.
Sie passierten ein schmales Wäldchen, dessen Bäume einen erdigen, frischen Geruch zu ihm herübertrugen. Später folgte eine wilde Landschaft mit Grasbewuchs und Büschen, die schließlich in Weideland und Felder überging. Auf einem der Felder befanden sich einige Männer und zwei Ochsen, die vor Pflüge gespannt waren.
„Wie ich dachte, das ist Serdicia”, sagte der hagere Mann mit der Narbe wenig später und deutete auf eine Ansammlung von Häusern und Türmen, die sich vor ihnen erstreckte.
Schon bald erreichten sie die Stadtmauer, dort hielten die Wagen vor dem massiven geöffneten Tor, an dem sich mehrere Wächter aufhielten. Lucius konnte nicht hören, was weiter vorn gesprochen wurde, doch es dauerte nicht lange, ehe sich die Gefährte erneut in Bewegung setzten. Die staubige Straße war in der Stadt an den Seiten mit Steinen befestigt. Sie fuhren vorbei an kleineren und größeren Häusern, manche davon aus Stein, andere aus Holz. Reiter passierten ihren Weg, Bauern mit ihren vollbeladenen Karren, bis hin zu Kindern, die fröhlich lärmend am Straßenrand spielten. Lucius nahm das alles nur am Rande wahr, denn der schmerzende Knoten in seinem Magen nahm inzwischen seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch.
Die Gefängniswagen wühlten sich durch den Verkehr, bis sie schließlich vor einem großen steinernen Gebäude hielten, in dessen Nähe sich mehrere Marktstände befanden.
Ein reges Treiben herrschte dort, Händler priesen ihre Waren an, Marktschreier waren über den ganzen Platz hinweg zu hören. Zahlreiche Stadtbewohner schlenderten zwischen den Ständen hindurch, manche von ihnen beladen mit Körben oder Beuteln. Aus mehreren Holzkäfigen drang das Gackern von Hühnern und die Geräusche anderer Vögel. Die Ausdünstungen von Unrat, der am Straßenrand lag, vermischten sich mit den Gerüchen von rohem Fleisch, frisch gebackenem Brot und verschiedenen Gewürzen, eine Mischung, die Lucius‘ Übelkeit noch weiter befeuerte.
Als ein bewaffneter Mann die Tür des Wagens öffnete, erkannte Lucius, dass es kein Entkommen gab. Zwar hätte der Markt in unmittelbarer Nähe gute Möglichkeiten geboten, ungesehen in der Menge unterzutauchen, doch so weit würde er gar nicht kommen; eine ganze Reihe an Bewaffneten hatte sich unmittelbar vor den Wagen in einem Halbkreis aufgestellt, mit griffbereiten Schwertern und Dolchen. Sie trugen rote Tuniken und darüber schwere Lederrüstungen, während ihre Arme und Beine von metallenen oder ledernen Schienen geschützt wurden, wie sie auch die Soldaten des Kaisers im Kampf trugen. Lucius vermutete, dass es sich um Stadtwachen handelte, denn diese trugen meistens Rot. Auch die Machart der Rüstungen sprach dafür.
Einige dieser Männer trieben nun die Gefangenen aus den beiden Wagen in das große Gebäude. Lucius stolperte, als er aus dem Gefährt kletterte. Einer der Wächter griff nach seinem Arm und zerrte ihn grob weiter. Er wehrte sich nicht dagegen, um sich nicht noch mehr Ärger einzufangen. Severin war noch immer in seiner Nähe.
Im Inneren des Gebäudes, dessen Dach von Säulen getragen wurde, war es ein weniger kühler. Dort gab es eine weitläufige Halle, auf deren Boden eine dünne Schicht Stroh lag. Eine Markthalle für Vieh, erinnerte Lucius sich an die Worte des hageren Mannes, der irgendwo zwischen den anderen Gefangenen verschwunden war.
Lucius und seine Leidensgenossen mussten sich in einer Schlange aufstellen, die langsam die Halle durchquerte, bis hin zu deren anderen Ende. Mit einem Mal stand Severin nicht mehr in seiner Nähe. Suchend blickte er sich um. Und was hatten die Wächter mit ihnen vor?
Читать дальше