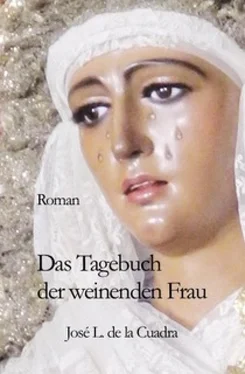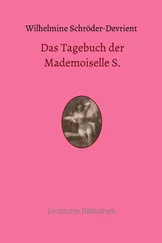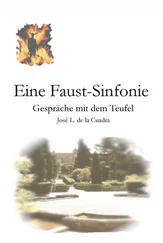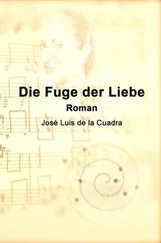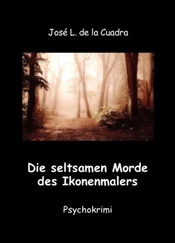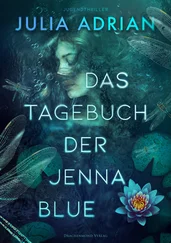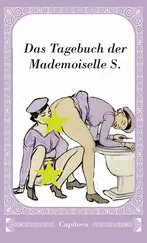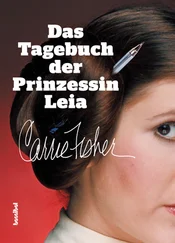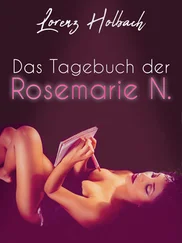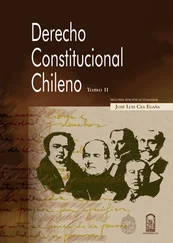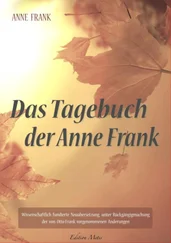Wenn ich nicht ständig durch diesen Klinikarzt in die Untiefen meiner kaputten Seele gestoßen würde, wäre ich längst genesen. Ich finde, dieses Tagebuch ist es Wert, eines Tages von irgendjemandem gelesen zu werden. Aber von niemandem aus der Klinik. Ich meine, von jemand normalem.
Jetzt kommt, worauf ich hinauswill, lieber Leser: Ich habe die ‚Weinende Frau’ gesehen. Ich meine eine dieser Varianten, in meinen Augen die schönste. Und ich habe sie nicht in einem Museum gesehen, nicht in Paris, nicht in New York. Nein, sie hängt in einem prächtigen Patio in Sevilla. Und wie kommt sie dorthin? Hier liegt des Pudels Kern. Wenn ich weitererzähle, wird das Ausmaß menschlicher Arroganz Ihnen die Augen öffnen. Sie werden erfahren, wie der männliche Geist Scheußlichkeiten verherrlicht und das Leiden der weiblichen Existenz schürt, wie die Hoffnung auf ein Ende von Zerstörung und Gewalt einzig und allein in den Tränen der Frau liegt. Jetzt haben Sie verstanden: in den Tränen der ‚Weinenden Frau’.
Ich weiß nicht, was Sie über den zweiten Weltkrieg wissen. Nachdem Hitler seine Bomberstaffel in Spanien in Schwung gebracht hatte, konnte er seine kranke Vision kriegerisch in die Tat umsetzen. Nach den ersten Erfolgen im Osten Europas besetzte er die nördliche Hälfte Frankreichs und Paris. Die zentralen und südlichen Teile des Landes überließ er dem ihm freundlich gesinnten Vichy-Regime unter General Pétain. Es kam nicht ungelegen, dass der Schöpfer des „entarteten Bildes“ ‚Guernica’ in Paris wohnte. So konnte er durch die Gestapo leicht überwacht werden.
Was ich Ihnen zu lesen gebe, habe ich nicht kriegshistorisch herausgefunden. Nein, ich habe es retrospektiv ermittelt. Ich meine damit, dass ich es aus heutigen Beobachtungen gefolgert habe. Meine wichtigste Beobachtung war das Erblicken der ‚Weinenden Frau’ im Patio eines Großindustriellen in Sevilla. Er ist der Inhaber von Montebarro Industries, einer bekannten Steinbruchfirma in Estepa. Seine Villa liegt im Stadtteil El Arenal in Sevilla.
Als ich meine Ausbildung zur Kunsthistorikerin begann, war ich in seinem Haus zu Besuch. Ich wurde eingeladen. Seine erste Frau, Maria Nieves Garcia y Vilar, eine gebildete Dame der sevillanischen Gesellschaft, hatte einige Kurse an der kunsthistorischen Universität besucht. Dort haben wir uns kennengelernt. Sie erzählte mir von der Bildersammlung ihres Mannes. Ich erfuhr erst später, dass ihr Mann der Geschäftspartner meines Vaters war. Die Frau imponierte mir wegen ihrer Schönheit und wegen ihres jugendlichen Alters. Ich glaube, sie war nur wenig älter als ich – und sie kleidete sich wie eine Königin.
Wir haben im Patio Tee getrunken. Umgeben von Azaleen und kleinen Orangenbäumen. Ich spürte, dass sie sehr stolz war auf das Anwesen. Sie führte ein komfortables und sorgenfreies Leben, wenn man davon absah, dass sie ihren Mann nicht liebte und er nur ihren Körper begehrte (Sie werden es mir nicht glauben, aber das hat sie mir erzählt).
Als ich das Gemälde sah, ein schmerzverzerrter Frauenkopf mit triefenden Augen und dreieckigen Tränen, war ich zugleich fasziniert und abgestoßen. Fasziniert, weil die tiefgründige Traurigkeit in diesem Gesicht eine beeindruckende Schönheit in sich barg. Lidia bemerkte mein Erstaunen und sagte:
„Das ist ein Picasso, die ‚Weinende Frau’. Bist du überrascht?“
Ich war völlig perplex. Ein Picasso in einer Privatvilla Sevillas?
„Wie kommt ihr zu einer solchen Kostbarkeit?“
„Durch meinen Mann. Er ist weit herum gekommen in der Welt. Während des zweiten Weltkriegs war er in Paris. Du weißt, Picasso war auch dort. Mein Mann hat mir nie Genaueres erzählt. Sein Leben ist voller Geheimnisse, wirklich aufregend. Irgendwie mag ich das an ihm. Ich glaube, die beiden haben sich getroffen, vielleicht waren sie befreundet, oder so. Wahrscheinlich hat der Maler ihm das Bild geschenkt.“
„Dein Mann war während des zweiten Weltkriegs in Paris? Unter der deutschen Besatzung? War das nicht gefährlich?“
„Nun, du weißt, Franco und die Deutschen ...“
Hier brach sie das Gespräch ab. Als ich nachdoppeln wollte, sagte sie nur:
„Komm, wir wechseln das Thema. Ich hasse Gespräche über Kriege. Nimmst du noch Tee?“
Und so beendeten wir den Nachmittag mit unbedeutendem Geplänkel. Aber in meinem Hirn hatte sich dieser angefangene Satz, „Franco und die Deutschen“, festgesetzt. Er hatte sich richtiggehend hineingebohrt. Kurz bevor ich mich verabschiedete, kam ihr Mann. Er war mittleren Alters. Sein Gesichtsausdruck war hart und kantig. Zu meinem Erstaunen hatte er hellbraune Haare, ungewöhnlich für einen Südspanier. Er fixierte mich unanständig und abschätzig, als mich Lidia vorstellte. Sein Blick glitt über meinen ganzen Körper und blieb an meinen Brüsten hängen. Ich verabschiedete mich rasch und verließ die Villa mit einem unangenehmen Nachgeschmack.
Am Abend erzählte ich meiner Familie vom Besuch bei Lidia. Die Reaktion meines Vaters überraschte mich. Er erklärte, dass Montebarro zwar sein Geschäftspartner sei und er ihn sehr schätze, aber er verlangte von mir, jeden weiteren Kontakt mit ihm oder seiner Frau zu vermeiden.
Damit war der Samen meines Misstrauens gesetzt. Ich begann, die Geschichte der deutschen Besatzung Frankreichs und insbesondere das Wirken der Gestapo in Paris zu erforschen. Was ich dabei herausfand, bestärkte meinen Verdacht. Nicht nur hatte Franco durch die spanische Botschaft in Paris seine rächenden Hände nach Picasso ausgestreckt (ein Mordanschlag auf ihn scheiterte), sondern auch die Gestapo war hinter dem Maler her. Er galt als Kommunist (später ist er tatsächlich der kommunistischen Partei Russlands beigetreten), seine Werke wurden in den Sammeltopf „entartete Kunst“ geworfen und durften nicht mehr ausgestellt werden. Es gab eine ‚Akte Picasso’. Unzählige Male erhielt er Besuch vom Sicherheitsdienst der SS und ebenso häufig wurde seine Wohnung unter fadenscheinigen Begründungen durchsucht. Man bediente ihn mit Gerüchten über eine bevorstehende Deportation.
Können Sie, lieber Leser, verstehen, dass sich in meinem Kopf ein Knäuel Gedanken bildete, der zu einem handfesten Verdacht heranschwoll?
Ich klappte das Buch zu. In der Hotelhalle sitzend überlegte ich die nächsten Schritte. Ich hatte über Nacht entschieden, dass ich meine Reisepläne ändern wollte. Die Anspielungen Varandas ließen die Notiz Laura Bascasas in einem neuen Licht erscheinen. Gab es eine Verbindung zwischen dem Inhalt des Buchs und dem darin versteckten Zettel? War Laura wegen einer alten Nazigeschichte in Gefahr? Nach den anfänglichen Äußerungen der Wut und Empörung, hatte der Essay einen erstaunlich nüchternen, beinahe wissenschaftlichen Ton angenommen. Die Autorin bereitete den Leser auf etwas vor, das in ihr herangereift war, wozu sie aber die Worte noch nicht fand.
Ich konnte mir mit bestem Willen nicht vorstellen, worauf Varanda hinauswollte. Das Gemälde ‚Weinende Frau’ im Patio einer sevillanischen Herrschaftsvilla, der Maler im besetzten Paris, unter Beobachtung durch die Gestapo. War es denkbar ...?
Neugierig las ich weiter.
„Hier wohnt doch Monsieur Lipchitz, nicht wahr?“
„Nein, hier wohnt Monsieur Picasso“, sagte der Privatsekretär zu den uniformierten Deutschen.
„Monsieur Picasso ist nicht zufällig Jude?“
„Natürlich nicht.“
„Wir wollen die Wohnung durchsuchen, um sicherzugehen.“
Der Sekretär kannte das Spiel. Es war nicht das erste Mal, dass SS-Offiziere einen Besuch abstatteten. Sie durchstöberten jeweils die ganze Wohnung.
„Wo ist Monsieur Picasso?“
„Er sitzt im Badezimmer, weil es dort am wärmsten ist. Sie wissen, es gibt nicht mehr genug Strom zum Heizen.“
Читать дальше