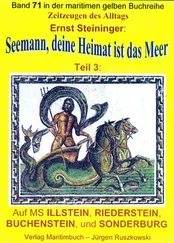Dorthin will ich und ich traue
mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
treibt mein Genueser Schiff.
Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit: -
Nur dein Auge – ungeheuer
blickt mich’s an: Unendlichkeit!
Friedrich Nietzsche

Also gab ich mich entschlossen, schulterte meinen nagelneuen, mit Klamotten voll gestopften „Seesack“, bewegte mich wiegenden Schrittes vom Bahnsteig über die Verbindungstreppen zur geräumigen, imposanten Schalterhalle. Dort hielt ich erst einmal inne, um mich zu orientieren. Der Liegeplatz des Schiffes war mir bekannt. Der war am jenseitigen Ufer der Weser, dicht an der Eisenbahnbrücke, die parallel zur Stephani-Brücke verläuft und die Bremen–Mitte mit dem Stadtteil Neustadt verbindet. Das ist vom Hauptbahnhof und zu Fuß ein ganz schönes Ende. Während ich noch überlegte, fiel mein Blick auf einen jungen Mann, der – ebenso ausgerüstet wie ich – ebenso ratlos in die Gegend guckte. Wir machten uns bekannt und stellten amüsiert fest, dass wir fast denselben Dialekt sprachen: Der „Kollege“ stammte aus Niederbayern…
Unisono beschlossen wir, uns den Luxus eines Taxis zu leisten. Guten Mutes entstiegen wir dann dem Taxi und standen unvermittelt vor dem schwarzen Eisenrumpf des an dicken Dalben angebundenen Segelschiffes. Die sich uns darbietende Backbord-Seite war in einer Linie von vorn bis hinten von kleinen kreisrunden, fest verschlossenen Bullaugen durchlöchert. Drei mit nackten Rahen bespickte Masten ragten wie Jakobsleitern in die tief hängende graue Wolkenschicht. Von der Uferböschung zum Schiff führte eine stabile Holzbrücke, an deren landseitigem Ende sich ein Wachhäuschen befand. Darin stand ein schneidiger Junge, angetan mit einer langen, marineblauen Flatterhose, einer marineblauen Matrosenbluse und einer dunkelblauen Pudelmütze. Der wies uns den Weg, ohne sich weiter um uns zu kümmern oder sonst irgendwie behilflich zu sein. Also schleppten wir unsere Seesäcke über die schmale, mit Handläufen versehene glitschige Holzbrücke, an deren Ende wir über eine kurze hölzerne Treppe auf die ebenso glitschigen Holzplanken des Hauptdecks gelangten.
So, bis hierher hatte ich es geschafft. Endlich, endlich war ich am Ziel! Stolz und Genugtuung schwellten meine doch noch etwas schmächtige Seemannsbrust: Aber ach, dieser Zustand euphorischen Hochgefühls währte nur kurz. Direkt vor uns hatte sich breitbeinig ein kleiner, grantig blickender „Klabautermann“ aufgebaut. Das offensichtlich missmutig gestimmte Männchen in dunkelblauer Schiffermontur mit dem roten, zerfurchten Krebsgesicht unter der flachen Schiffermütze war kein anderer als der berühmt-berüchtigte Bootsmann Mau. Einige bange Augenblicke lang musterte er uns verächtlich, so wie eine satte Spinne, die zu faul ist, ihre Opfer anzuspringen. Dann plötzlich – meine Knie begannen bereits weich zu werden – blökte er uns unvermittelt an: „Ihr vom Land herein geschissenen Mistbauern, was steht ihr hier dumm rum und glotzt Bauklötze. Bewegt gefälligst eure Ärsche und seht zu, dass ihr unter Deck verschwindet!“ Sprach’s und schob uns beide sehr energisch in Richtung Niedergang…
Bootsmann Mau – ein „old sailor“ von echtem Schrot und Korn – war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Seine Autorität wurde von niemandem auch nur angezweifelt. Die „kernigsten“ unter uns angehenden Schiffsjungen, die ihn wie einen maritimen Guru umschmeichelten und umschwänzelten, durften sich unter seiner Obhut schon einiges erlauben. Ich gehörte nicht dazu… Und so gab es auch reichlich Ärger für mich, als ich doch einmal beim verbotenen „Aufentern“ in die Masten erwischt und verpetzt wurde. Die Aussicht, im Wiederholungsfall gefeuert zu werden, verleidete mir dieses seemännisch-sportliche Vergnügen für den Rest meiner Anwesenheit an Bord. Überhaupt wurden meine Vorstellungen vom abenteuerlichen, romantischen Seemannsleben, woran ein gewisser Herr „Ringelnatz“ auch nicht ganz unschuldig war, schon bald schwer erschüttert. Hoch oben, in der Saling des Großtopps, da ließ es sich noch träumen von der Weite des Meeres; von Gischt schäumenden, anrollenden Wellenbergen, im brüllenden Sturmwind dahinjagenden Windjammern, von Kap Hoorn, von Feuerland…

Segelschiffe
Sie haben das mächtige Meer unterm Bauch
und über sich Wolken und Sterne.
Sie lassen sich fahren vom himmlischen Hauch
mit Herrenblick in die Ferne.
Sie schaukeln kokett in des Schicksals Hand
wie trunkene Schmetterlinge.
Aber sie tragen von Land zu Land
fürsorglich wertvolle Dinge.
Wie das im Winde liegt und sich wiegt,
Tauwebüberspannt durch die Wogen,
da ist eine Kunst, die friedlich siegt,
und ihr Fleiß ist nicht verlogen.
Es rauscht wie Freiheit. Es riecht wie Welt. –
Natur gewordene Planken
sind Segelschiffe. – Ihr Anblick erhellt
und weitet unsere Gedanken.
Ringelnatz

… Feuerland, wie es Magellan noch vorfand, mit vielen Feuerchen an allen Ecken und Enden, an denen sich die pudelnackten einheimischen Indios wärmten. Ich hingegen, was sah ich? Ich sah auf die Stahlkonstruktion der Eisenbahnbrücke; sah die Silhouette der Stephani-Kirche und nächtens, vom Europahafen herüber strahlend, das rötlich-lila leuchtende Reklameschild von „Reidemeister und Ullrich“…
Der Anfang meiner Seemannskarriere war halt alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte. Einige von uns Jungs wurden mit irgendwelchen Funktionen betraut, die zum laufenden Schiffsbetrieb gehörten. Mich steckte man, aus welchen Gründen auch immer, in die „Pantry“. Das ist die Anrichte für die Offiziersmesse. Ich hatte somit die zweifelhafte Ehre, die Herren Offiziere bedienen zu dürfen. Für mich brach eine Welt zusammen, ich war wie am Boden zerstört. Matrose wollte ich werden – und nicht Kellner! Ich wehrte mich vehement, doch weder Tränen der Wut noch Tauschvorschläge – lieber wollte ich Heizungswart, Ascheträger oder sonst was sein – fruchteten etwas. Es war beschlossene Sache. Von wem? Vielleicht von Mau, der mir nicht gewogen war – auf alle Fälle aber von Kapitän K., und das war ein massiger, stiernackiger, rundköpfiger Bayer. Nachdem ich in den Job eingeführt war, merkte ich aber bald, dass er nicht nur Nachteile hatte. Nicht nur, dass ich nicht bei jedem Scheißwetter irgendeine Scheißübung mitmachen musste – durch meinen Pantry-Dienst war ich immer wieder verhindert. Auch die Vorteile einer Pantry-Kombüse-Connection sollte ich bald schätzen lernen.
Die Kombüse war in dem schmalen, niederen Decksaufbau auf dem Vorschiff untergebracht, die Kabinen des Kapitäns und der Offiziere achtern unter dem erhöhten Poopdeck. Dort befanden sich auch meine „Wirkungsstätten“, die Pantry und die O-Messe. Diese räumliche Distanz bedingte, dass ich als „Essensträger“ der ständigen „Hänselei“ meiner Kameraden ausgesetzt war, von denen nicht wenige neidisch auf meinen lukrativen Job waren. Das „Lukrative“ für mich war mein gutes Verhältnis zur „Mutti“, der mir wohlgesinnten, schon ein wenig betagten Köchin. Sie sah, wenn auch bissig witzelnd, so doch milde lächelnd über meine „natürliche“ Abneigung gegen norddeutsche Essenszubereitung hinweg. Zum Beispiel: zermanschter Grünkohl, der mich lebhaft an frisch hingeschissene Kuhfladen erinnerte, oder wässrig-teigige Klöße, die auch im Entferntesten nichts mit einem festen Mehl- oder Semmelknödel gemein haben. Dank Muttis Beistand – in Form von Pudding-Nachschlägen und allerlei anderen Leckereien – und dank der kondensierten Dosenmilch für das Offiziersfrühstück, die ich, wenn auch rationiert, im Kühlschrank „meiner“ Pantry verwahrte, überlebte ich diese erste schlimme Zeit elementarer „Fress-Zäsur“ (der Gerechtigkeit halber: Nach einer etwas längeren Karenzzeit begann mir die Norddeutsche Kost durchaus zu munden. Mittlerweile gehört Grünkohl mit Pinkel in der kalten Jahreszeit zu meinen Wunschgerichten.)
Читать дальше