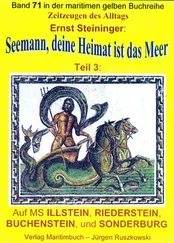Zurück zum Bach: Während mein Bruder nach allem griff, was er in die Finger bekam – und das waren eben nicht nur Fische, sondern auch Handgranaten, Karabiner, Panzerfäuste – war ich bemüht, das Gelände zu erkunden. Stück für Stück erforschte ich den Bachlauf von der Quelle bis zu seiner Mündung in den nächsten größeren Fluss, die Aschach. Von der wusste ich, dass sie zur Donau hin fließt. Die Donau! Der große Strom, von dem ich träumte, dass er mich eines Tages bis ans Meer tragen sollte...
Eines Tages – im Verlaufe eines Schulausfluges – war es dann so weit: Ich stand am Ufer des gewaltigen Flusses. Der Anblick der damals noch ungefesselten Wassermassen, die sich ungestüm durch die Enge des Aschacher Kachlets zwängten und sich gleich danach, beruhigt und behäbig in das Eferdinger Becken ergossen, hypnotisierte mich…
Im Kachlet selbst mühte sich ein Raddampfer mit langen Eisenkähnen an langen Seilen stromaufwärts. Die riesigen Schaufelräder schienen auf der Stelle zu drehen. Es knirschte und knarrte, als ob sie mehr über Grund ackerten als durchs Wasser schaufelten. Auf der Kommandobrücke stolzierten bemützte Männer hin und her, und die lange, schräg nach hinten geneigte Schornsteinröhre paffte unablässig schwarze Wolken in den blauen Himmel. Das Vorschiff fiel von der Schiffsmitte schräg nach vorn ab, was dem Schiff ein wunderliches Aussehen verlieh, so als ob es sich in die anstürzende Flut verbeißen wollte. Stockend, ächzend, pfeifend und qualmend quälte es sich durch das unbekümmert vorbeirauschende Wasser. Müßig zu sagen, wie sehr mich dieser Anblick faszinierte; müßig zu sagen, was da in mir reifte…
Um die vierte Klasse unserer Volksschule machten alle Schüler, die da nicht unbedingt hinein mussten, einen respektvollen Bogen. Diese Klasse unterstand direkt dem autoritären, uneingeschränkt über sein „Reich“ herrschenden Oberlehrer Frosch. Renitente Jungs aus anderen Klassen, gegen die sich die „Fräuleins“ nicht zu helfen wussten, wurden ihm noch während des Unterrichts vorgeführt. Hei, was war das doch immer wieder für eine willkommene Abwechslung, wenn dann so ein Delinquent vor unser aller Augen „Scheitelknien“ musste. Aus der Sicht unserer Elterngeneration galt der Herr Oberlehrer zwar als „streng, aber gerecht“. Aus der Sicht eines Schülers aber war Frosch alles andere denn gerecht. Er war auch nicht das, was man ihm als nur „streng“ unterstellen könnte; nein, er war schlicht brutal. Ein Himmler-Typ: Rundköpfig, runde Nickelbrille, kurz geschorenes, rechts gescheiteltes Haar – wie es rassenhygienisch bis vor kurzem noch Pflicht war. Neben seiner Eigenschaft als Schulleiter war er auch Organist der Kirchengemeinde und als solcher für den musikalischen Nachwuchs zuständig. Das sah dann so aus, dass er die von ihm als unmusikalisch Eingestuften so lange mit dem Bogen seiner Violine traktierte, bis sie von ihrer Unmusikalität überzeugt waren. Dazu zählte natürlich auch ich. Jahre später revanchierte ich mich für diese Gemeinheit, indem ich als selbstbewusster junger Seemann – lauthals Seemannslieder grölend – nächtens vom Dorfwirtshaus nach Hause zog…
Dass der Rohrstock das beliebteste Lehrmittel dieses perversen Erziehers war, versteht sich von selbst. Ich galt zwar als brav, weil ich Ministrant war, und habe den Stock lediglich als massive Drohung in Erinnerung. Nur einmal, da hatte ich Pech: Eine von mir nur durch den Mittelgang getrennte Mitschülerin verpetzte mich wegen irgendeiner Kleinigkeit. Oder? Die Strafe, die der Tat auf dem Fuß folgte, lässt darauf schließen, dass es vielleicht doch eine größere Kleinigkeit war. Na sicher, war es doch ausdrücklich verboten, die Mädchen auch nur wahrzunehmen. Das war weniger schwierig, als man denken möchte. Die durchwegs, bis auf ganz wenige Ausnahmen, mausgrauen und langzopfigen Landmädchen waren, jedenfalls für mich, eigentlich kein Grund, auf „dumme“ Gedanken zu kommen. Die Strafe für mein Vergehen war „Glockenläuten“. Das ging so: Der Oberlehrer, ein gestandenes Mannsbild in den besten Jahren, fasste mich am Hosenboden und den Hosenträgern, hob mich waagerecht in die Luft und bumste mich, wie einen menschlichen Glockenschwengel, mit dem Kopf voran, gleich mehrere Male gegen die stabile Schreibtafel. Das war schon arg, so vor der ganzen Klasse unter dem Gejohle der Buben und dem Gekreische der Mädchen gedemütigt zu werden. Allerdings, oh Wunder, hinterher vermeinte man wirklich eine Zeitlang, so etwas wie Glockengeläut zu vernehmen...
Der Mann hatte aber auch seine guten Seiten. Denn, wenn man bei ihm auch nichts Konkretes lernte, so war er doch ein begnadeter Geschichtenerzähler. Wie ein Bänkelsänger stand er – mit Stock, versteht sich – vor der großen Landkarte der großen Donaumonarchie und erzählte in schwelgerischer Weise aus der guten alten Zeit; von seinen Schiffsreisen auf der Donau von Wien bis ans Schwarze Meer. Zum Abschluss der „Geschichtsstunde“ fuhr er mit dem „Zeigestock“ von der Nord- über die Ost- bis zur südöstlichen Grenze des so kläglich zusammengeschrumpften Österreich. Und in dramatischer Pose verwies er auf die akute Gefahr, die von den abtrünnigen slawischen Völkern ausgehe…
Das waren die Stunden, in denen ich seine Bösartigkeit vergaß und voller Aufmerksamkeit an seinen Lippen hing. Seinem Stocke folgend, schiffte ich mich in Wien ein, zollte Budapest die gebührende Achtung, mied Belgrad wegen der „aufsässigen, hundsgemeinen Serben“, wand mich mit meinem Schiff durch das Eiserne Tor, drang bis zur Dobrudscha vor, gelangte endlich ans gelobte Meer; Thalassa! Thalassa!
Mein Stiefvater – mein leiblicher Vater war als vermisst gemeldet und blieb es auch – war Schrotthändler. Das brachte ihn auf die Idee, aus dem Schutt der zerbombten Lagerhallen des Linzer Donauhafens geborgenes, grotesk verbogenes Moniereisen aufzukaufen. Anschließend wurde der Schrott mit dem „Opel Blitz“, einem „ausgedienten“ Wehrmachts-LKW, nach unserem rund 40 Kilometer entfernten Dorf transportiert. Am häuslichen Lagerplatz wurden dann die Eisenstangen mit dem Vorschlaghammer auf dem Amboss leidlich gerade geklopft, um so wiederum an die Bauern der Umgebung als wieder verwertbares Betoneisen verkauft zu werden. Das war schon Knochenarbeit; für die ich als schmalbrüstiger Junge jedoch keineswegs zu schade war. An der Linzer Oberen Donaulände, die wir bei diesen Gelegenheiten stets passierten, lagen zwei große Raddampfer, die „SATURN“ und die „URANIA“, einstens der Stolz der österreichischen Donauflotte zwischen Wien und Konstanza. Man hatte die beiden Passagierschiffe, um sie dem Zugriff der Roten Armee zu entziehen, noch schnell vor Kriegsende von Wien nach Linz verlegt. Ich konnte sie immer nur flüchtig im Vorbeifahren bestaunen. Waren es doch die Schiffe „meines“ Oberlehrers – als Hotelschiffe für den Rest ihres Daseins an der Kaje angebunden…
Meinem Stiefvater oblag es auch, das in der Umgebung liegengebliebene Kriegsmaterial einzusammeln und zu verschrotten. Dazu gehörte auch das Einsacken von Nazi-Literatur aus diversen Schulbibliotheken. Für mich, der ich doch alles verschlang, was auch nur im Entferntesten nach Schiffen und Abenteuer roch, war dieser Lesestoff eine gefährliche Falle… Waren sonst so unschuldige Bücher wie die „Schatzinsel“, „Das Geheimnis der Inka-Insel“ Quellen meiner Fantasie, so hielt ich nun plötzlich schuldbeladene Bücher in meinen Knabenhänden. Hauptsächlich waren es die mit vielen Fotos illustrierten Bücher, Almanache der soeben untergegangenen Kriegsmarine. Binnen kurzer Zeit wurde ich ein „Experte“ in Sachen Seekriegsführung, kannte alle Seeschlachten beider Weltkriege und die dazu gehörenden Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe mit Namen. Einzig zu Torpedo- und U-Booten hatte ich ein gestörtes Verhältnis, vermutlich, weil sie anstelle anständiger Namen – wie „SCHARNHORST“, „GNEISENAU“, „BISMARCK“, „PRINZ EUGEN“ – lediglich eine „Nummer“ hatten. In dieser Zeit verschlechterte sich die ohnehin schwierige Beziehung zu meinem Stiefvater gravierend; er nahm mir nämlich diese Bücher einfach weg! Ich sah mich nun gezwungen, sie mir heimlich aus dem Lagerschuppen, in dem sie auf ihrem Weg in die Papiermühle zwischengelagert wurden, „auszuleihen“…
Читать дальше