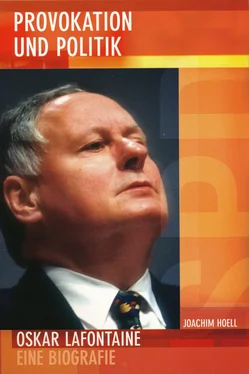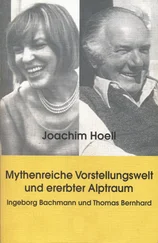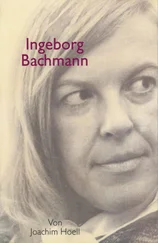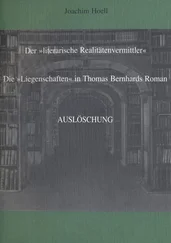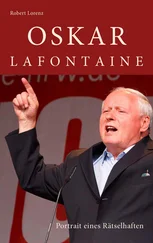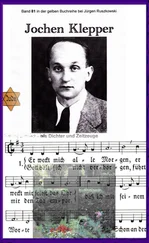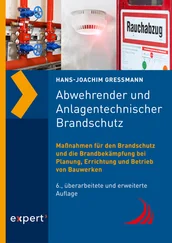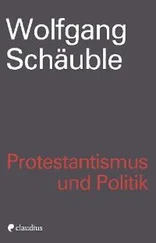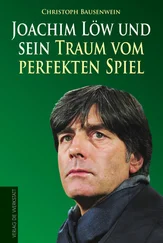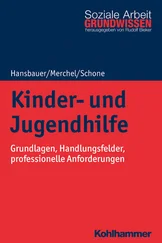Bernd Niles und Oskar Lafontaine beziehen bei Niles Onkel gemeinsam ein Zimmer. Vier Semester werden sie dort in brüderlicher Gemeinschaft leben, bevor Oskar Lafontaine sich ein eigenes Zimmer nimmt. Die beiden sind seit Prümer Zeiten eng befreundet. Niles war Leiter der Schola, bei der Oskar so eifrig mitsang. Er brillierte als Klassenprimus in allen Fächern und galt dabei als angenehmer Schulkamerad. Er verließ wie Oskar vorzeitig das Konvikt und lebte bis zum Abitur in einer Prümer Privatunterkunft. Nachdem sie die lang ersehnte Freiheit ein Jahr lang gemeinsam in Prüm genossen, wollen die beiden nun die Bundeshauptstadt erobern.
Oskar Lafontaine schreibt sich an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität ein. Er belegt Kurse in angewandter Physik und Chemie, muss dabei zahlreiche Praktika absolvieren und schwierige Klausuren in Mathematik bestehen. Doch Lernen sei ihm immer leicht gefallen, wie Oskar Lafontaine gern erwähnt. Nebenbei beschäftigt er sich mit philosophischen und geschichtlichen Fragen, auf die die Gymnasiasten in Prüm nie Antworten erhielten. Bundesweit setzt in den 60er Jahren erstmalig eine kritische Auseinandersetzung mit dem Faschismus ein. Zunächst an den Hochschulen, bevor weitere Gesellschaftskreise erreicht werden. Von den Priestern und Lehrern in Prüm wurde die jüngste politische Vergangenheit geflissentlich ausgespart, erst jetzt erfahren die jungen Studenten vom Ausmaß der nationalsozialistischen Gräueltaten. An der Existenz Gottes regen sich Zweifel, denn wie konnte er solche Verbrechen zulassen? Für die ehemaligen Konviktoristen, die mit dem hohen moralischen Anspruch der Kirche konfrontiert wurden und dabei die Verlogenheit ihrer irdischen Vertreter erleben mussten, besteht ein Sinn-Vakuum, das neu gefüllt werden muss – politische Arbeit liegt da nahe.
Zunächst gerät Oskar Lafontaine jedoch in ähnliche Kreise wie in Prüm. Ein Religionslehrer des Regino-Gymnasiums hatte ihm empfohlen, sich für ein Stipendium des Cusanuswerks, der Bischöflichen Studienförderung, zu bewerben. Nach dem ersten Semester, das er mit guten Noten abschließt, erfüllt er die Voraussetzungen für eine Bewerbung – und er bekommt das Begabtenstipendium, das ihm über das gesamte Studium zustehen wird. Mit Büchergeld beträgt die monatliche Beihilfe 350 DM, eine Summe, mit der man in der Zeit auskommen kann. Das Cusanuswerk fördert seine Stipendiaten nicht nur mit Geld, sondern auch in Form eines umfangreichen Bildungsprogramms. Ziel der katholischen Stiftung ist es, die Stipendierten »in ihrem Verantwortungswillen zu bestärken und dazu zu befähigen, Dialoge zwischen Wissenschaft und Glauben, Gesellschaft und Kirche anzustoßen.« Jeder Stipendiat ist dazu verpflichtet, an den Ferienakademien und an anderen Veranstaltungen des Cusanuswerks teilzunehmen. Oskar Lafontaine setzt sich also wieder mit der grundsätzlichen Frage auseinander, wie man ein Leben als verantwortungsbewusster Christ führt. Im Gegensatz zu den dogmatischen Klerikern in Prüm findet er intellektuelle Gesprächspartner aus akademischen Kreisen.
Lafontaine habe das Studium mit »minimalem Aufwand« betrieben, sagt er heute. Er habe viel gelesen in dieser Zeit, Camus und Sartre seien seine Lieblingsautoren gewesen, und gemeinsam mit seinem Freund Bernd Niles besucht er philosophische Vorlesungen. Niles studiert zunächst Griechisch, Latein und Philosophie, bevor er zur Germanistik wechselt; heute unterrichtet Niles, der mit seinem alten Gefährten Oskar noch in freundschaftlichem Kontakt steht, als Linguist am Germanistischen Seminar der Universität Bonn. Lafontaine verlässt Bonn noch während des Studiums. Ansonsten habe Oskar Lafontaine ein typisches Studentenleben geführt, »viele Feste wurden gefeiert«, und »der Drang des Mannes zum Weibe« habe großen Raum in seinem Leben eingenommen.
Die Semesterferien verbringt er hauptsächlich im heimischen Pachten. Er wohnt bei seiner Mutter in der Fischerstraße und geht gut bezahlten Ferienjobs nach, auf der Dillinger Hütte im Stahlbau und auch einmal auf dem Dillinger Finanzamt. Dem Saarland ist er über die Jahre im rheinland-pfälzischen Prüm und im nordrhein-westfälischen Bonn eng verbunden geblieben, auch räumlich hat er sich nie mehr als 200 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt.
Bei einem der Ferienaufenthalte noch zu Abiturzeiten lernte er während eines Ausflugs Ingrid Bachert kennen. Sie ist die Wirtstochter in einem Lokal, in das er mit Freunden einkehrt. Aus dieser ersten Begegnung wird schnell eine feste Beziehung. Ingrid Bachert ist zwei Jahre älter als Lafontaine, hat eine kaufmännische Lehre abgeschlossen und arbeitet in einem Unternehmen in der Werbeabteilung. Später wird sie ein Geschäft mit Glaskunst führen. Oskar Lafontaine fasst ihretwegen den Entschluss, Bonn den Rücken zuzukehren und nach Saarbrücken zu wechseln.
Ab dem Sommersemester 1965 setzt er sein Studium an der Universität des Saarlandes fort. Oskar Lafontaine und Ingrid Bachert ziehen beide nach St. Johann, einem Stadtteil von Saarbrücken, wo auch das Rathaus des Oberbürgermeisters steht. Vorerst leben sie in getrennten Wohnungen, allerdings im selben Haus. Bereits ein Jahr später entschließen sie sich zu heiraten. Die kirchliche Trauung findet in einem der schönsten Klöster des Saarlandes statt, in St. Gangolf, unweit der berühmten Saarschleife bei Mettlach. Oskar Lafontaine ist noch keine 24 Jahre alt, als er im Sommer 1967 mit Ingrid Bachert – die Braut traditionell ganz in Weiß – vor den Altar tritt.
Die frisch Vermählten ziehen in eine Vierzimmerwohnung auf den Saarbrücker Eschberg, Pater-Delp-Straße 50. Ihre Einkünfte sind nicht hoch, aber Oskar Lafontaine hat neben dem Stipendium, das durch die Heirat ein wenig aufgestockt wird, und den regelmäßigen Ferienjobs mittlerweile auch eine Assistentenstelle an der Uni. Er veranstaltet zweimal in der Woche Praktika für Studenten der Medizin und Naturwissenschaften und erhält dafür immerhin 220 DM.
Wie schon in Bonn besucht er auch in Saarbrücken Vorlesungen in Staatsrecht und Philosophie. Noch gut im Gedächtnis sind ihm Vorlesungen bei Werner Maihofer, Dekan und Rektor an der Universität des Saarlandes. Der Jurist wird 1972 von Willy Brandt als Minister für besondere Aufgaben ins Kabinett gerufen, unter Helmut Schmidt ist der FDP-Mann von 1974 bis 1978 Bundesinnenminister. Lafontaine hört bei ihm Vorlesungen über ›Ideologien‹ und über den ›jungen Marx‹.
Doch vor allem treibt er zielgerichtet sein Physikstudium voran. In Bonn hatte er ein gutes Vordiplom in Physik abgelegt, in Saarbrücken wird Experimentalphysik zum Schwerpunkt seines Studiums. Anfang 1967 beginnt er am Institut für Experimentalphysik eine Diplomarbeit über die Zucht von Bariumtitanat. Zwei Jahre wird er mit Laborversuchen beschäftigt sein, in denen er eine höchst komplexe Versuchsreihe zu Einkristallen aufbaut. Er macht sein Diplom mit dieser Arbeit über Festkörperphysik: Er sei ein »Experte für ein bestimmtes Material in einem bestimmten Temperaturbereich eines bestimmten Frequenzbereiches« gewesen, wie er im Nachhinein seine Abschlussarbeit umschreibt. Das Studium, das seine »Fähigkeit zum exakten Denken« weiterentwickelt habe, schließt er im Februar 1969 als Diplom-Physiker ab: »Es war kein Spitzenexamen. Aber mit der Gesamtnote ›Zwei‹ hatte ich noch ein gutes Examen geschafft, obwohl mein Fleiß, mein Engagement an der Uni in den letzten drei Jahren merklich nachgelassen hatten«. Das verminderte Interesse am Studium liegt an einer neuen Priorität in seinem Leben.
Bereits im Januar 1966 tritt Oskar Lafontaine in die SPD ein: Landesbezirk Saar, Unterbezirk Saarbrücken, Ortsverein St. Johann. Den Eintritt in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands begründet er damit, dass die Postulate der Bergpredigt und die christliche Nächstenliebe am ehesten in dieser Partei befolgt werden, mehr als in der CDU, die das ›C‹ im Namen führt. Die religiöse Erziehung, von früh auf durch die Mutter und dann im Prümer Internat, habe sein Weltbild dahingehend geprägt, dass er den Anspruch des Christentums in praktische Politik übersetzt sehen möchte: Nächstenliebe gleich Solidarität. »Hier verbündet sich die katholische Erziehung mit dem heutigen politischen Denken«, so Oskar Lafontaine. Die reaktionären, teilweise nazistischen Lehrer und Priester in Prüm waren fast alle Unionsmitglieder, und deren »Pharisäertum und Heuchelei« habe ihn abgestoßen. »Unter allen denkbaren Lösungen – und da spielte die Erfahrung aus Prüm eine wichtige Rolle – war die SPD die einzig mögliche Entscheidung für mich damals«, sagt Lafontaine heute.
Читать дальше