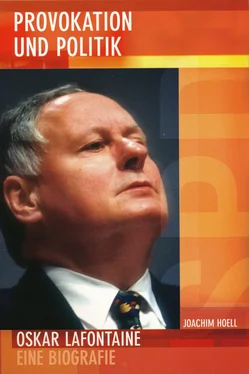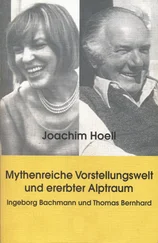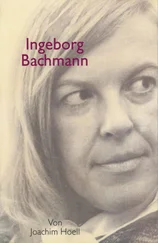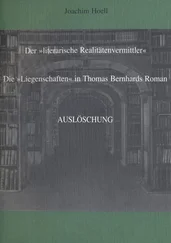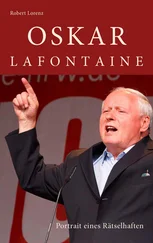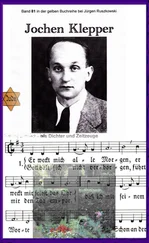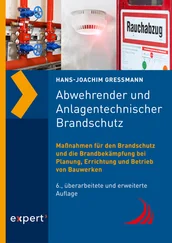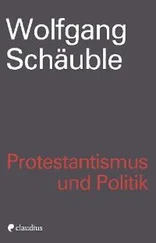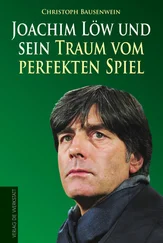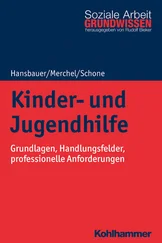Der Alltag in Prüm sieht Ringen ebenso vor wie Singen. Auch im Gymnasium steht Sport auf dem Lehrplan, und da der Erdkunde- und Sportlehrer Josef Kessler einst deutscher Vizemeister im Boxen war, nimmt dieser Sport großen Raum im Unterricht ein. Er führt die Schüler in alle Tricks des Boxsports ein, teilweise kommt es zu wüsten Faustkämpfen, bei denen schon mal Blut fließt. Oskar findet großen Gefallen am Boxen und ist ein zäher Kämpfer, der auch lernt, wie man den Gegner gekonnt niederstreckt.
Überhaupt hat Oskar in Prüm bald den Ruf weg, mit Fäusten und Worten hart zuzuschlagen. »Wer ihn angriff, musste sich warm anziehen und mit brutalen Reaktionen rechnen. Gnadenlos konnte er Kameraden niedermachen, körperlich und verbal. Seine sarkastischen Sprüche und verletzenden Anwürfe waren gefürchtet. Für ihn ein Stück Belustigung, für die Nichtbetroffenen beliebte Unterhaltung. Oskar suchte die Konfrontation, doch er suchte sich auch Opfer, die er fertigmachen konnte«, so ein Mitschüler. Nach eigenem Bekunden war er manchmal »ein richtiger Deiwel«. Vieles in Prüm, ob im Konvikt oder im Gymnasium, ist auf Macht und Dominanz aufgebaut. Die autoritären Methoden der Aufsichtspersonen, die katholische Zucht im Internat und die pädagogische Strenge in der Schule übertragen sich auf die Schüler, insbesondere auf die kasernierten Konviktoristen. Der Aggressionsstau entlädt sich gegenüber unterlegenen Schülern und zartbesaiteten Lehrern.
Die Lehrer im Gymnasium und die Priester im Konvikt sind sehr konservativ. Sie fühlen sich der ›alten Schule‹ verpflichtet, in der harte Disziplinarmaßnahmen bis zur Prügelstrafe als pädagogisches Mittel gelten. Die Regino-Schule dient im Kultusministerium von Rheinland-Pfalz der Strafversetzung für unliebsame Lehrer, weil Prüm so abgelegen ist. Nicht wenige der Lehrer von Oskar haben eine Nazi-Vergangenheit. Als ehemalige NSDAP-Mitglieder waren sie mit Berufsverbot belegt, bevor sie nach Prüm beordert wurden. Alle sind streng katholisch, viele politisch in der CDU organisiert.
Eine der umstrittensten Gestalten in der Prümer Lehrerschaft ist Erwin Schneider, der Klassenlehrer von Oskar und Hans. Ein unverbesserlicher Militarist, der seine politischen Überzeugungen unverhohlen äußert. Schneider macht es sich zur Angewohnheit, nationalsozialistische Lieder und Märsche zu pfeifen, während er die Bankreihen seiner Schüler im Stechschritt abgeht. Der »Onkel«, wie er bei den Schülern genannt wird, ist alles andere als beliebt. Mit Oskar versteht er sich allerdings bestens. Der ist sein Lieblingsschüler, umgekehrt ist Schneider Oskars Lieblingslehrer. Seine Noten sind auch sehr gut – Schneider unterrichtet naturwissenschaftliche Fächer –, aber dem Lehrer gefällt vor allem Oskars Charakter. »Oskar war sein Mann, dem er alles zutraute, der alles erstklassig beherrschte. Er spürte seine Intelligenz und Kraft, Schneider verehrte und liebte begabte Schüler, verachtete und schikanierte Untalentierte und Dumme«, wie ein Klassenkamerad urteilt. Der »Onkel« unterstützt seinen Schützling wo es nur geht, stellt ihn vor der ganzen Klasse heraus und befördert somit dessen Eitelkeit und Hochnäsigkeit. Zwischen dem kinderlosen Lehrer und dem vaterlosen Schüler entwickelt sich ein enges Verhältnis, wobei er kein Ersatzvater gewesen sei. »Eine prägende Figur war er für mich schon. Er hat vielen Mitschülern Probleme bereitet. Mich behandelte er wie ein Hätschelkind, das eben sehr begabt war, wie er meinte.« Zwischen seinen unerträglichen politischen Meinungen und seinem fachlichen Können hätte er zu unterscheiden gewusst. »Er war kein besonders guter Pädagoge für schwächere Schüler. Er konnte kommandieren und demütigen. Schneider brachte Schüler zur Verzweiflung. Mich hat er immer geschont und gelobt.« Das besondere Verhältnis zu Schneider hat auch Folgen für Oskar Lafontaine: »Er war mitverantwortlich für meine Entscheidung, Physik zu studieren. Ohne seinen nachhaltigen Einfluss hätte ich auch Sprachen oder Jura machen können«, urteilt er heute. Der Hardliner Schneider verkündet noch 1990, dass er kein Anhänger der Demokratie sei und die Monarchie für die beste Staatsform halte. An Oskar Lafontaine schreibt der ehemals stolze Lehrer später wütende Briefe, weil er mit dessen Politik überhaupt nicht konform geht – als »Vaterlandsverräter« und »moskauhörig« beschimpft er ihn.
Das Internat lenken ebenfalls resolute Erzieher. Der Konviktsdirektor Peter Hammes, der sich für die Aufnahme von Hans und Oskar verwendet hatte, ist berüchtigt für seine Strafmaßnahmen. Mit einer aus Lederriemen geflochtenen Peitsche züchtigt der Priester die ihm Anbefohlenen schon für kleinere Vergehen wie das unerlaubte Pflücken von Erdbeeren. Sein Nachfolger ab 1958, der Priester Helmut Löscher, wird noch mehr als Hammes von den Konviktoristen gehasst. »Er war ein Psychopath und verkörperte die neurotische Seite des Christentums, Hammes und Löscher existieren für mich bis heute als Alptraumfiguren«, erinnert sich ein Konviktorist. Löscher drängt mit regelrechtem Psychoterror darauf, dass sich alle Zöglinge auf eine anschließende Priesterlaufbahn festlegen, ansonsten flögen sie gleich aus dem Konvikt. »Die Konviktsleitung versuchte uns zu indoktrinieren«, so Oskar Lafontaine. »Wir haben uns dagegen aufgelehnt, als unser Bewusstsein kritischer wurde.« Löscher verteufelt auch jede Form von Sexualität, Onanie gilt als Todsünde, Duschen und Baden muss entsprechend zügig vonstatten gehen. Kontakte zu Mädchen sind sowieso rar, und Löscher beobachtet mit dem Fernrohr, was seine Zöglinge in der Stadt treiben. In der Schule gibt es ohnehin reine Jungenklassen, so dass kaum Kontakte zum anderen Geschlecht bestehen. »Die sexuelle Entwicklung des jungen Menschen wurde brutal unterdrückt. Wer anfällig für die gepriesenen Ideale des Konviktsdirektors war, sah in jeder Frau entweder die Jungfrau Maria oder eine Nutte. Wie wir unsere eigene Mutter zu begreifen hatten, war ein Rätsel«, urteilt ein Konviktorist.
Der saarländische Schriftsteller Alfred Gulden, im Prümer Konvikt ein Jahrgang unter Lafontaine, heute der engste Freund aus Konviktzeiten, beschreibt in seinem Roman ›Die Leidinger Hochzeit‹ (1984) die Erziehung unter Internatsleiter Helmut Löscher: »Keiner von ihnen ist Priester geworden. Keiner hat sich einlullen lassen von den dümmlichen Reden des Herrn Direktors. Im Gegenteil. Geradezu gierig hatten sie, kaum aus dem Konvikt, Kontakt zu den Mädchen gesucht. Nachholbedarf, hatte Erich gelacht. Und sie hatten erkannt, was sie, noch im Konvikt, nur vermutet hatten: verdreht, völlig verdreht waren die Ansichten des Herrn Direktors gewesen. Abschreckung, keine Frau anzurühren, des Teufels die Weiber, in sich das Böse.«
Sich hier behaupten zu können, verlangt den Konviktoristen viel ab. Unter der Jungen sind Schlägereien und Machtkämpfe an der Tagesordnung. Die Schwächeren werden zu Sklavendiensten für die Stärkeren herangezogen, mit Gemeinheiten und Demütigungen reagiert man sich an Jüngeren und Hilflosen ab. Oskar setzt sich hier durch, er genießt eine unangefochtene Vormachtstellung in der Gruppe, die er auch ausspielt. Dass er immer Vorsänger im Kirchenchor, Mittelstürmer auf dem Fußballplatz und Anführer jedes Klassenkrawalls gewesen sei, betont er später stolz, auch, dass er »physisch ganz schön auf der Höhe« gewesen sei, sprich: die anderen verdroschen habe. »Ich habe mich gut behauptet in diesem Klüngel von Jungs – Raufen, Stellungskämpfe, so wie ihn junge Hunde oder Katzen austragen. Weil ich auch die notwendigen körperlichen Kräfte hatte, fiel mir das leicht. Ich war dann Klassensprecher, ich konnte mich in Gruppen gut zurechtfinden – das ist sicherlich eine Grundlage für die späteren politischen Aktivitäten gewesen, dass ich mich in diesem Konvikt gut behauptet habe. Diese Zeit war prägend, ich musste dort mein soziales Verhalten üben.«
Читать дальше