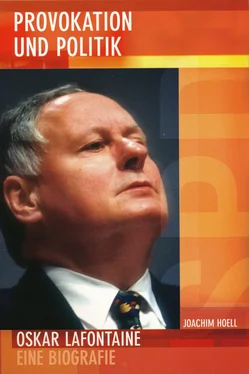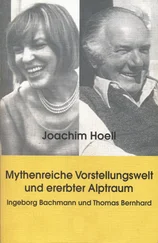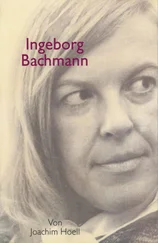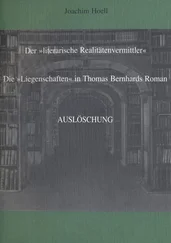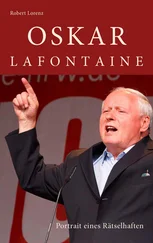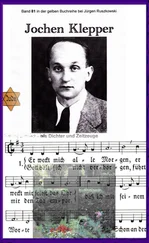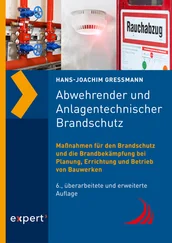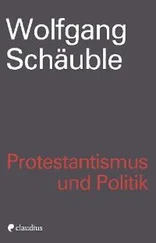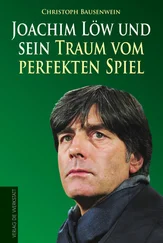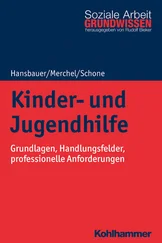Gegenüber der Konviktsleitung verhält er sich moderat, er habe nicht rebelliert und die klerikale hierarchische Ordnung respektiert, so ein Mitkonviktorist. Opponiert habe er schon, das enge Korsett habe ihm nicht behagt, so Lafontaine heute. In einem Aufsatz im Konvikt, ›Welche Formen des Anstands und der Höflichkeit sind für mein Alter angebracht?‹, vom 26. Juni 1956, schreibt der 12-jährige Oskar: »In meinem Alter sind die Jungen in den sogenannten Flegeljahren. In diesem Alter befallen uns die Versuchungen besonders stark, und daher fällt es uns manchmal schwer, uns zusammenzureißen. Wir müssen also in unserem Alter schon einigen Wert auf Anstand und Höflichkeit legen. In dem Hause, in dem wir uns befinden, wird die Versuchung noch dadurch verstärkt, daß wir eine ganze Horde sind. Wir sind wohl auch die schwerste Last für die Aufsichtsperson. Wenn diese nicht das nötige Verständnis für uns zeigt, kommen wir meistens nie gut zusammen aus. Zum Glück ist dies im Hause nicht der Fall. Die Aufsichtspersonen bringen uns gegenüber das nötige Verständnis auf, und so versuchen auch wir, ihnen gegenüber dasselbe aufzubringen. Zwar bringen wir dies manchmal nicht fertig, aber an unserem Willen sieht man doch, daß wir den Sinn des Hauses erfaßt haben. Unter uns müssen wir auch Anstand und Höflichkeit zeigen. Wir müssen auf Unseresgleichen Rücksicht nehmen und zur Gemeinschaft in unserem Hause nach besten Kräften beitragen.«
Für die kurz vor dem Abitur stehenden Konviktoristen werden Zucht, Ordnung und Eingesperrtsein immer quälender. Im Sommer 1960 bittet Hans Lafontaine seine Mutter, sich in Prüm ein Zimmer außerhalb des Internats nehmen zu dürfen. Der stille und verschüchterte Bruder hält es nicht mehr aus, er gehörte immer zu den Unterlegenen in der Gruppe, auch wenn Oskar seine schützende Hand über ihn hielt. Außerdem wäre Hans wahrscheinlich sowieso ausgeschlossen worden, da er unerlaubterweise zu einer Sportveranstaltung gegangen war. Einem Rauswurf kommt er mit seinem Auszug zuvor.
Oskar folgt seinem Bruder bald nach – allerdings auch nicht freiwillig. Nach einer Probe der Schola sucht er mit ein paar anderen Sängern eine Kneipe auf, wo sie mehrere Gläser Bier trinken. Als die Anstaltsleitung davon erfährt, fliegen alle »verruchten Sünder« hochkant aus dem Konvikt. Nach knapp acht Jahren ist der Aufenthalt im Bischöflichen Konvikt Prüm für Oskar Lafontaine jäh beendet. Die Absicht, Priester zu werden, hatte er schon längst nicht mehr.
Im Februar 1961 bezieht er ein Zimmer in Prüm. Er kommt bei dem Polizistenehepaar Gierten im Achterweg 7 unter. Ein kleines Zimmer unterm Dach, mit geringem Komfort, aber er ist froh, dem Konvikt entkommen zu sein. Bis zum Abitur fehlt nur noch ein gutes Jahr. Für die Mutter entstehen durch die Privatunterkünfte ihrer Söhne noch mal Extrakosten, aber Oskar kann durch Nachhilfeunterricht wenigstens ein bisschen Geld hinzuverdienen.
Nach der jahrelangen Kasernierung und totalen Kontrolle im Internat kann er das letzte Jahr in Prüm etwas freizügiger verbringen. Zunächst muss er sich an die neu entstandene Freiheit gewöhnen. Kneipen, Kino, Kegeln – völlig neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die im Konvikt verboten waren. Als Pubertierender habe er langsam angefangen, sich »für Mädels zu interessieren«. Im letzten Schuljahr trifft er dann bei einem Aufenthalt im Saarland Ingrid Bachert, seine erste große Liebe, die er Jahre später heiraten wird.
Mit anderen Konviktaussteigern gründet er den »Club der Ehemaligen«, das Gruppenleben hat alle geprägt und will zu einem Teil beibehalten werden. Mit dem Chor unternimmt er in diesem Jahr die Frankreichreise durch russisch-orthodoxe Klöster, die ihn besonders beeindruckt. Das letzte Jahr in Prüm geht schnell vorüber, allein die Vorbereitung auf das Abitur kostet viel Zeit und Mühe.
Am ›Staatlichen Regino-Gymnasium‹, die Schule trägt seit dem Wiederaufbau und der Einweihung neuer Schulgebäude im Sommer 1961 diesen Namen, legt Oskar Lafontaine im März 1962 das Abitur ab. Er schließt mit überdurchschnittlicher Leistung ab, der Note ›gut‹, denn »unsere Lehrer waren damals der Ansicht, dass es keine Schüler gebe, die ein ›sehr gut‹ verdient hätten«, so Oskar Lafontaine. Wegen eines Streiches, an dem er beteiligt ist – der Griechischlehrer setzt sich in die präparierte Wasserlache auf seinem Stuhl –, wäre beinahe die gesamte Klasse um ein Jahr zurückversetzt worden. Doch in letzter Minute können Oskar und der Übeltäter durch eine Entschuldigung beim erzürnten Lehrer ihre Klasse vor dieser Schmach bewahren.
Die Abiturienten des Jahrgangs 1962 bilden bis heute eine verschworene Gemeinschaft. Alle fünf Jahre kommen sie zum Klassentreffen in Prüm zusammen. Das Regino-Gymnasium befindet sich weiterhin in der alten Benediktinerabtei, das Bischöfliche Konvikt ist mit Ende des Schuljahres 1999/2000 geschlossen worden.
Oskar bricht Ostern 1962 aus Prüm auf. Das Städtchen in der Eifel wird er nicht sehr vermissen, aber die Internats- und Gymnasiumsjahre haben ihn geprägt. Ein Jesuitenzögling, wie es später immer wieder über ihn heißt, ist er allerdings nicht, ein Bischöfliches Konvikt ist kein Jesuitenkolleg. »Mit Jesuiten hatte ich nur Kontakt in den Exerzitien, das Jesuitische habe ich nicht unkritisch gesehen.« Weltanschauliche Parallelen zu Jesuiten gebe es schon, beispielsweise zu Heiner Geißler (CDU), der heute auch quer gegen seine Partei stehe: »Man bleibt den eigenen aus dem Christentum abgeleiteten Auffassungen treu.« Die katholische Erziehung habe einen moralischen Kodex, die humanistische Erziehung »eine grundsätzliche, methodische Herangehensweise an ein Thema« entstehen lassen: »Bei den heute Handelnden wie Schröder oder Merkel vermisse ich die philosophisch-literarische Bildung, während man mit einer humanistischen Bildung immer wieder angehalten ist, sich zu fragen: Was heißt denn Freiheit, was heißt denn Solidarität, wie definierst du das überhaupt?« Den altsprachlichen Zweig beurteilt er im Rückblick als »eine gute Grundlage des Denkens, weil Latein und Griechisch zur Exaktheit zwingen und einen guten Einstieg in die Philosophie darstellen«.
Im Konvikt bildet der jugendliche Oskar Lafontaine seine natürlichen Anlagen aus. Das Internat ist eine Schule der Disziplin, und diese Schule besteht er glänzend. Kraft und Intelligenz stellt er in den Dienst eines Systems, in dem er sich souverän behauptet. In den Internatsjahren wird er geformt. Er entwickelt emotionale und soziale Intelligenz, lernt Rang- und Hackordnungen kennen, erfährt Demütigung und Befriedigung, aber auch Freundschaft und Solidarität. Darüber hinaus erlernt er Fertigkeiten und erkennt Fähigkeiten: Humanistische Bildung, mit der er intellektuell bestechen kann, rhetorische Begabung, mit der er argumentativ zu überzeugen vermag. Er erwirbt das Rüstzeug für Größeres.
3 Ich mach’ den Vorsitz. Studium (1962–1969)
Gleich nach dem Abitur nimmt Oskar Kurs auf Bonn. Schon im letzten Schuljahr in Prüm stand für ihn fest: Physik zu studieren und zwar in Bonn. Ausschlaggebend für die Studienwahl sind seine ausgezeichneten Leistungen in diesem Fach, manche Physikaufgaben bei Lieblingslehrer Schneider habe er als einziger zu lösen vermocht. Für Bonn entscheidet er sich, weil sein Prümer Schulfreund Bernd Niles dort einen Onkel hat, bei dem beide unterkommen können.
Als der 18-jährige Student Oskar Lafontaine zum Sommersemester 1962 in der Hauptstadt eintrifft, regiert Konrad Adenauer als erster Kanzler der Bundesrepublik bereits im vierzehnten Jahr. Adenauer muss seit der letzten Wahl eine Koalition mit der FDP bilden, die absolute Mehrheit hat seine CDU verloren. Ende des Jahres gibt der 86-Jährige bekannt, im folgenden Jahr sein Amt niederzulegen, auch ein Tribut an die ›Spiegelaffäre‹ und das Ausscheiden mehrerer Minister im Oktober 1962. Ludwig Erhard wird vom Ministerposten auf den Kanzlerthron aufrücken. Dagegen ist die SPD seit dem Godesberger Programm von 1959 im Aufwind. Mit dem neuen, von Herbert Wehner durchgesetzten Grundsatzprogramm verabschiedet sich die Partei von marxistischem Gedankengut und bekennt sich zur Sozialen Marktwirtschaft sowie zur Westbindung der Bundesrepublik. Aus der alten Arbeiterpartei wird eine moderne Volkspartei. Der neue Kurs der SPD hat auch personelle Konsequenzen. Willy Brandt löst Erich Ollenhauer als Kanzlerkandidaten ab, Ollenhauer bleibt SPD-Parteivorsitzender. Auch wenn Brandt bei der Bundestagswahl 1961 Adenauer unterliegt, gibt er der Partei Hoffnung, die SPD endlich auch bundesweit in die Regierung zu bringen. In Landesparlamenten sind die Genossen bereits auf dem Vormarsch. Brandt ist beliebt als Regierender Bürgermeister von Berlin, Helmut Schmidt hat sich im Februar 1962 als Hamburger Innensenator bei der Hochwasserkatastrophe einen Namen als Krisenmanager gemacht. Durch den Bau der Berliner Mauer, der bei Oskars Eintreffen in Bonn noch nicht einmal ein Jahr zurückliegt, haben die eigentlichen Jahre der Bonner Republik gerade erst begonnen.
Читать дальше