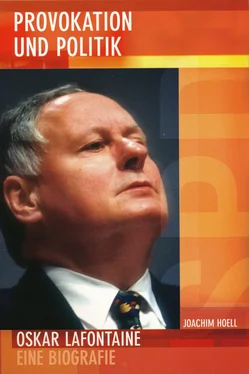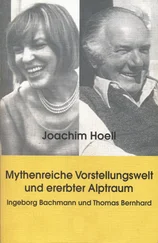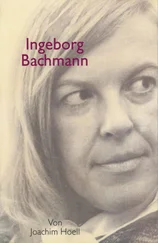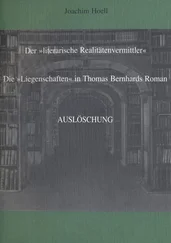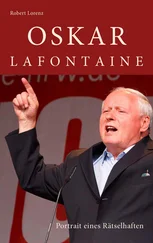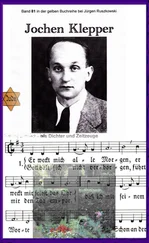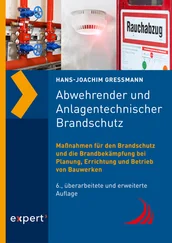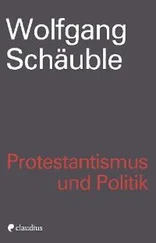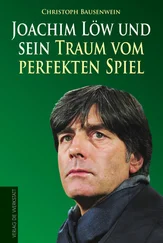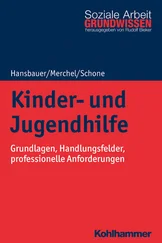Auch die Tagesordnung fordert viel ab von den Neun- bis 18-jährigen. Morgens um fünf Uhr betritt der Präfekt den Schlafsaal, auf ein »Gelobt sei Jesus Christus« springen alle aus den Betten, stellen sich auf und antworten mit einem »In Ewigkeit Amen«. Danach geht es nach kurzem Waschen und Anziehen zum Morgengebet mit anschließender Heiliger Messe in die Konviktskapelle. Nach dem Gottesdienst folgt das Frühstück im großen Speisesaal, anschließend eilen sie zur Schule im Ort, wo sie in Reih und Glied in die Klassenräume marschieren müssen. Nach sechs Stunden Unterricht nehmen sie gemeinsam das Mittagessen im Konvikt ein. Um 15 Uhr beginnt in absoluter Stille das Studium, das mit kurzen Pausen bis 18.45 Uhr dauert, der Zeit für das Abendessen. Für die Oberstufe danach noch mal Studium, um 20.15 Uhr für alle das Abendgebet in der Kapelle. Spätestens um 21.30 Uhr ist Nachtruhe. Je nach Wochentag und Altersstufe variiert der Tagesablauf ein wenig, aber der strikte Rahmen gilt grundsätzlich für alle. Selbst die Freizeit ist durch einen »Pflichtausgang« geregelt, der mindestens zu dritt erfolgen muss. Dies gilt sogar noch für die älteren Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen. Kontrolle und Überwachung bestimmen auch die knapp bemessene Freizeit der Konviktbewohner.
Obwohl das streng reglementierte Leben für die Lafontaine-Zwillinge gewöhnungsbedürftig ist, fühlen sie sich allmählich im Konvikt wohl. Bereits beim ersten Besuch der Mutter soll Hans bei der Verabschiedung gesagt haben: »Mama, wenn du dich auch ärgerst, es gefällt uns im Konvikt besser als daheim.« Oskar Lafontaine erinnert sich gleichwohl, wie schwierig die Anfangszeit in Prüm war: »Ich habe das als Bruch, als Schock empfunden und brauchte eine Zeitlang, bis ich die Situation als junges Kind verkraftet hatte. Ich habe dann aber, wie Kinder eben sind, versucht, mich einzurichten.«
Beide finden Gefallen am Gruppenleben, neben der offiziellen Hausordnung gelten allerdings eigene Gesetze unter den 85 Jungen. Verschiedene Cliquen, meist identisch mit dem jeweiligen Jahrgang, scharren sich zusammen. Das Recht des Stärkeren spielt in jeder dieser Banden eine große Rolle, ohne körperliche Kraft und Durchsetzungsvermögen ist man der Gruppe ausgeliefert – die internatstypische Rang- und Hackordnung. Oskar gehört wie in der heimischen Fischerstraße schnell zu den führenden Köpfen, obwohl er einer der Jüngsten ist. Er sei alles andere als zimperlich und bald der Anführer seiner Clique gewesen. Den Zwillingsbruder habe er wie schon zuvor in Pachten geschützt, dieser wäre ansonsten in Prüm gescheitert, wie Mitkonviktoristen meinen.
In der Schule finden sich die Brüder ebenfalls schnell zurecht. Sie belegen den altsprachlichen Zweig mit erster Fremdsprache Latein, zweiter Griechisch und dritter Französisch. Das humanistische Gymnasium verlangt ihnen viel ab, aber beide sind den schulischen Anforderungen gewachsen. In der abgeschlossenen Atmosphäre von Benediktinerabtei und Bischöflichem Konvikt, zwischen Kreuzgang und Kapitelsaal, Bibliothek und Barockaula versenken sie sich nachmittags ins Studium. Ihre Noten sind gut, und bei Familienbesuchen legen sie die Zeugnisse stolz ihrer ehemaligen Grundschullehrerin Irmgard Hoffmann vor.
Nach Hause fahren die Konviktoristen nur in den Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien. Katharina Lafontaine besucht ihre Söhne alle drei Wochen, auch wenn die Reise beschwerlich und langwierig ist. Die Entfernung von Pachten nach Prüm beträgt zwar weniger als 200 Kilometer, doch da das Saarland noch nicht zur Bundesrepublik gehört, müssen Landes- und Zollgrenzen passiert und mehrfach die Transportmittel gewechselt werden. Sie bringt den Zwillingen Wäsche, Kleidung und Süßigkeiten mit und wohnt eine Nacht im Hotel. Diese Besuche an jedem dritten Wochenende sind für die Familie Lafontaine ein festes Ritual über die gesamten Prümer Jahre.
Viele der Mitschüler leben ebenfalls fern von ihren Familien. In der Regino-Schule kommt nur ein Drittel der Gymnasiasten aus dem Eifelstädtchen, das sind die Söhne wohlsituierter Prümer. Ein Drittel kommt aus der Umgebung, zumeist Bauern- und Handwerkersöhne, die täglich eine längere Anreise haben. Das letzte Drittel wird von Konviktoristen gestellt, hauptsächlich aus dem Prümer Konvikt, aber auch aus anderen katholischen Internaten in der Umgebung. Die Konviktoristen kommen fast durchweg aus ärmeren Familien, denn das katholische Internat bietet gerade Söhnen aus sozial schwachen Verhältnissen eine vergleichsweise günstige Ausbildung. Viele stammen auch aus Gegenden, in denen es keine weiterführenden Schulen gibt. Das eigentliche Ziel des Konvikts, nach dem Abitur Theologie zu studieren, um Priester zu werden, wird jedoch nur von wenigen weiterverfolgt. Oskar Lafontaine merkt dazu an, dass man als Neunjähriger noch gar nicht wissen konnte, was man will: »Das hat man anfangs gar nicht mitbekommen, was das Ganze eigentlich sollte. Erst später, als wir mündiger wurden, sind wir dahinter gekommen.« Aus Oskars Schulklasse entscheiden sich von 25 Abiturienten nur vier zum Theologiestudium, zwei davon werden zum Priester geweiht; die meisten werden später Lehrer.
Die religiöse Erziehung stellt im Lauf der Konviktszeit für viele eine immer größere Belastung dar. Über zwei Stunden am Tag ist Silentium, absolutes Sprechverbot, was vielen besonders schwer fällt. Die wirklich Frommen sind in der Minderzahl, die Mehrheit versucht, dem katholischen Drill zu entkommen. Auch Oskar Lafontaine erinnert sich noch gut an die intensive religiöse Erziehung: »Jeden Morgen Gottesdienst, um sechs Uhr in der Frühe. Ich war auch Messdiener. Das heißt: Ich habe für mein Leben ausreichend Messen besucht.« Für Studium, Beten und Meditation ist für den Geschmack der meisten Zöglinge viel zu viel Zeit, der Bewegungsdrang der heranwachsenden Jungen verlangt nach anderen Aktivitäten. Sport ist daher die beliebteste Freizeitbeschäftigung für die Konviktoristen. Oskar tut sich beim Fußball besonders hervor, bereits mit 14 spielt er als Jüngster in der ersten Mannschaft des Konvikts. Das sportliche Angebot wird nach dem Umzug in den Neubau im Jahr 1957 durch einen konvikteigenen Sportplatz mit Aschenbahn, Tennisplatz und diversen Sportgeräten erweitert.
Neben Sport ist Musik besonders beliebt. Dafür stehen genügend Mittel bereit, im Konvikt genießt musische Betätigung hohes Ansehen. Musiklehrer für Blas- und Streichinstrumente, für Klavier und Orgel unterrichten die Schüler, teilweise für ein kleines Aufgeld. Der Kirchenchor und die verschiedenen Orchester im Konvikt haben oft Anlass aufzutreten, ob bei gewöhnlichen Sonntagsgottesdiensten oder an Feiertagen. Oskar spielt kurzzeitig Trompete, beschränkt sich dann aber auf das Singen in der Schola. Diese umfasst zehn Sänger und wird von einem Mitschüler als Organisten geleitet. Bernd Niles an der Orgel erinnert sich noch gut an den leidenschaftlichen Chorsänger: »Oskar war ein toller Sänger. Er beherrschte sämtliche Stimmen. Ich brauchte ihm nur ein Zeichen zu geben, dann konnte er den Tenor verstärken oder in den Bass hinuntergehen. Oskar war wendig. Mit seinem Gehör spürte er, wo es stimmlich fehlte, und er sprang dort ein.« Das Repertoire der Schola reicht von Gregorianik über Mozart, Beethoven und Schubert bis hin zu Gospels. Oskar Lafontaine erinnert sich, wie wichtig ihm die Musik im Konvikt war. »Hierbei entwickelte ich das erste Mal Sinn für Ästhetik. Für meine musikalische Bildung war das von Bedeutung. Bis zum Ende der Schulzeit sang ich in der Schola mit.« Die hochgelobte Schola tritt auch außerhalb der Konviktsmauern auf, eine Reise führt die jungen Sänger nach Frankreich, wo sie in russisch-orthodoxen Kirchen auftreten. Oskar Lafontaine wird seine sängerischen Qualitäten später nutzen: Mit Gefühl für den richtigen Takt stimmt er Lieder bei Wahlkampfauftritten an oder singt aus voller Kehle auf Straßenfesten.
Читать дальше