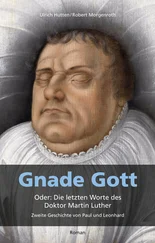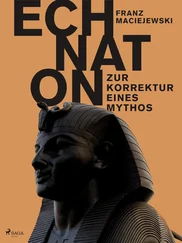Meiner elitären Klientel mute ich keine Wartezeit zu. Es gibt Termine, die ich peinlich genau einhalte. Es reicht auch nicht ein Patient dem anderen die Klinke in die Hand. Ich selbst gönne mir zwischen den Sitzungen eine entspannende Ruhepause, fasse das soeben Gehörte unter Nutzung meiner Aufzeichnungen in einem Diktat für meine Sekretärin zusammen und bereite mich dann auf den nächsten Patienten vor. Frau Seidel sitzt im Vorzimmer und beherrscht perfekt die Terminplanung. Ich weiß, ihre Arbeit füllt sie nicht aus und übersehe daher das Buch, das sie unter dem Tisch verschwinden lässt, wenn ich in ihr Zimmer komme. Das macht nichts. Ich kann sie mir leisten.
Auf ein Wartezimmer kann ich verzichten. Der Patient kommt zu mir wie ein Gast. Er soll sich im Ambiente meiner Praxis wohlfühlen, vielleicht sogar etwas von seinem eigenen Lebensstil wiederfinden. Hochfloriger dunkelbrauner Teppichboden dämpft jeden Schritt. Gemälde moderner Künstler hängen an den Wänden, die in einem gedeckten Weiß gehalten sind. Frau Seidel sorgt dafür, dass in einer Vase von originellem Design stets ein frischer Blumenstrauß steckt. Auf dem antiken Sideboard platziert sie ihn im goldenen Schnitt. Das Möbel aus Rosenholz, von Gustave Herter gefertigt, der eigentlich Hagenlocher hieß, habe ich ersteigert. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert und bildet einen Kontrast zu den Beistelltischen von Eileen Gray und den bequemen Ledersesseln von Charles Eames, auf denen meine Patienten Platz nehmen. Sie müssen nicht auf einer Couch liegen. Halb sitzend, halb liegend können sie sich völlig entspannt mir öffnen. Sie haben den Blick durch ein Panoramafenster, sehen ausschließlich den Himmel, nichts, was sie ablenken könnte von ihrer Konzentration auf ihr Inneres. Ja, im 23. Stockwerk sind Sie nahe den himmlischen Gefilden, sage ich manchmal scherzhaft, wenn jemand ans Fenster tritt und die Aussicht bewundert.
Selbst sitze ich seitlich von meinem Patienten. Er kann, wenn er will, sich zu mir drehen und mich anschauen oder seine Augen ziellos in das Blau oder Grau hinter den Scheiben schweifen lassen. Während er spricht, mache ich mir Notizen.
Nachdem sie sich gesetzt haben, sollen meine Patienten erst einmal fünf Minuten zur Ruhe kommen. Dann stelle ich ein oder zwei Fragen, lasse sie reden, was ihnen in den Sinn kommt und frage erst wieder nach, wenn längere Pausen eintreten. Liegt das Problem klar auf der Hand, bespreche ich es mit ihnen. Ich lenke sie jedoch darauf hin, dass sie lernen, auf ihre innere Stimme zu hören und im Einklang mit ihrem Wesen zu handeln. Und in der Tat, oft finden die Patienten die Lösung von allein, was am ehesten ein nachhaltiges Ergebnis verspricht. Am Ende fordere ich sie auf, noch fünf Minuten still sitzen zu bleiben, damit aufgewühlte Gefühle sich legen können. In der Zwischenzeit halte ich mich draußen bei meiner Sekretärin auf.
In der Regel sind die Krisen meiner Klientel nach sechs bis acht Sitzungen überwunden, was nicht heißt, dass sie auf Dauer stabilisiert sind. Manche kommen wieder nach Monaten oder nach ein, zwei Jahren, oft dann schon prophylaktisch, weil sie spüren, dass sie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten. Mir ist das recht, hält sich doch damit mein Einkommen konstant. Die chronischen Fälle mag ich nicht. Da komme ich mir oft vor, in einer Sackgasse zu stecken, nichts geht voran, kein Durchbruch. Aber sie sind eine verlässliche Einnahmequelle, und so ertrage ich sie, solange es nicht mehr als drei oder vier sind.
Ich komme zurück auf den 7. Mai, den warmen Frühlingstag, an dem eine Zäsur meinen gewohnten Praxisalltag zerbrach. Wenige Minuten zuvor war ein junger Mann, Ende Dreißig, gegangen. Seine erste Sitzung, in der ich als vertrauensbildenden Akt allgemeine Auskünfte über ihn erfragte: die Anamnese, seine privaten und familiären Verhältnisse, seinen Werdegang und das anstehende Problem. Er hatte dargelegt, dass er alleinstehend, leitender Angestellter einer Investmentbank sei und den Stress nicht mehr aushalte. Nach der einstündigen Exploration hatte ich ihm einen neuen Termin geben lassen und ihn verabschiedet.
Es war Mittagszeit. Eine Pause von gut zwei Stunden lag vor mir, und ich war mir noch nicht darüber klar geworden, ob ich unten in der Geschäftspassage einen Imbiss einnehmen oder einen Spaziergang am Flussufer machen sollte. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein
Mann trat herein. Offenbar hatte Frau Seidel ihren Platz bereits verlassen und machte irgendwelche Besorgungen, denn gegen derartige Überfälle war ich durch sie geschützt.
Ich erschrak nicht, war eher überrascht oder vielmehr erstaunt, dass es jemand geschafft hatte, unangemeldet in mein Sprechzimmer vorzudringen. Der Mann passte so ganz und gar nicht zu meiner Klientel. Vielleicht war er über seine Unverfrorenheit selbst verwundert. Jedenfalls blieb er, nachdem er die Tür rasch hinter sich geschlossen hatte, dort stehen. Mir sprang ins Auge, dass er trotz der Wärme, die draußen herrschte, einen dicken grauschwarzen Wollmantel mit Fischgrätmuster trug, offen, so dass ich sein braunes Hemd und die zu kurze braune Hose sehen konnte. Was mich jedoch befremdete, ja abstieß, war seine abgetragene, verschlissene Kleidung, hier und da fleckig, staubig, zerknittert und an den Kanten durchgescheuert. Die nackten Füße steckten in Schuhen, die deutliche Zeichen des Verschleißes zeigten, an den Fersen ausgetreten und an einem klaffte seitlich die Naht. Erst auf den zweiten Blick schaute ich ihm ins Gesicht, das ein zerrupfter Bart rahmte, der ansatzlos in struppiges dunkelblondes Kopfhaar überging. Seine Gesichtshaut schien ungewaschen und machte ihn alt. Die schlanke Nase und sein verständiger, freundlicher Blick stachen dagegen ab. Ich schätzte ihn auf Ende Fünfzig.
„Sie sind nicht angemeldet! Wie kommen Sie hier herein?“ Eine Entrüstung wollte mir nicht gelingen, vielleicht weil mein Verhalten berufsbedingt auf Deeskalation angelegt ist. Er musste sogleich bemerkt haben, dass ich nicht daran dachte, die Polizei zu alarmieren, sondern unschlüssig war, wie ich mit diesem unerwarteten Zusammentreffen umgehen sollte.
„Sie müssen mir helfen. Ich weiß, dass ich hier hereinplatze. Aber im Augenblick haben Sie Zeit, mich anzuhören“, sagte er mit einer suggestiven Kraft, die Widerspruch nicht zu kennen schien.
Innerlich sträubte ich mich dagegen und versuchte, diesen unerbetenen, fraglichen Patienten abzuwimmeln, indem ich ganz entschieden sagte: „Ich mache jetzt Mittagspause. Das sollten Sie respektieren. Termine vergibt meine Sekretärin, falls überhaupt noch welche in absehbarer Zeit frei sein sollten. Aber “, fügte ich absichtlich arrogant hinzu, „ich glaube nicht, dass Sie sich mich leisten können.“
„Machen Sie sich um Ihr Honorar keine Sorgen! Ich werde am Ende begleichen, was Sie verlangen.“ Das nun wiederum konnte ich mir absolut nicht vorstellen und überlegte hastig, mit welchem Einwand ich ihm meine ärztliche Hilfe noch versagen könnte. Er schaute sich um.
„Könnte es aber auch sein, dass Sie einmal helfen, ohne dafür bezahlt zu werden?“ Er trat ans Fenster. „Sie haben den Überblick über das menschliche Leben, und nicht nur über die Stadt.“ Er wandte sich wieder mir zu und zeigte auf den geräumigen Sessel. „Darf ich Platz nehmen?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, ließ er sich nieder und streckte die Beine gespreizt von sich.
Mir fiel keine schlagkräftige, den Überfall abwehrende Begründung ein. Nie hatte ich es in meinem Berufsleben mit aufdringlichen, ungepflegten Leuten zu tun. Und nie war mir auf solch rigorose Weise gezeigt worden, wie wenig Durchsetzungskraft ich besitze. So setzte ich mich denn mit einem Seufzer, den er hören sollte, und nahm mir vor, Frau Seidel anzuweisen, alles zu tun, dass mich dieser Mann nicht noch einmal belästige. Meinen Sessel rückte ich ein wenig nach hinten, um mich von seiner muffigen Ausdünstung, einer urinösen und säuerlichen Geruchsmischung, fernzuhalten.
Читать дальше