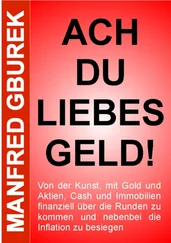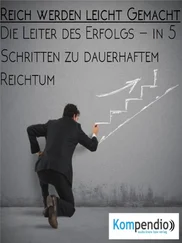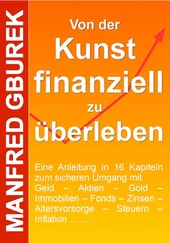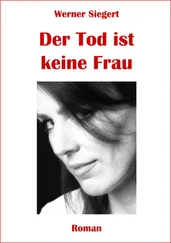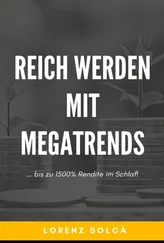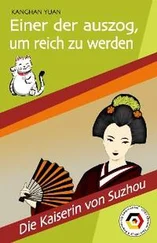So weit die mal mehr, mal weniger zurückliegende Vergangenheit. Keiner von den hier genannten Umbrüchen lässt sich ohne Wenn und Aber in die Zukunft fortschreiben. Neue Umbrüche werden kommen und gehen. Aber soll man deshalb als Anleger aufgeben und ihre Interpretation anderen überlassen? Nein! Denn die anderen haben im Zweifel weniger Durchblick als Sie; das gilt auch für die meisten Anlageberater. Verfolgen Sie doch einfach das, was zum Beispiel die Medien an nützlichen Informationen hergeben – leider gibt es auch viele unnütze, aber durch ständiges Verfolgen haben Sie bald den richtigen Dreh raus.
Eine probate Methode, etwas von dem mitzubekommen, was uns in Zukunft erwarten könnte, besteht im Verfolgen sogenannter Megatrends. Davon gibt es ein halbes bis ganzes Dutzend, je nachdem, wie man sie interpretiert, welche noch bestehen und welche sich bereits abschwächen. Hier folgt eine betont subjektive unkonventionelle Auswahl: Wir werden im Durchschnitt immer älter. Die Medizin macht sprunghafte Fortschritte. Frauen setzen sich zunehmend auch in Toppositionen durch. Die künstliche Intelligenz erzielt den Durchbruch. Wir werden im Geschäfts- wie auch im Privatleben total vernetzt. Die Städte platzen aus allen Nähten, an der Gegenbewegung aufs Land wird von Politikern herumgefeilt. Das Wirtschaftswachstum verlagert sich noch mehr als bisher vom Westen über die sogenannte Seidenstraße bis zum Fernen Osten. Englisch dringt als Weltsprache bis in den hintersten Urwald vor. Stellvertreterkriege an den globalen Brennpunkten und darüber hinaus setzen sich fort.
Geldillusion nennt man den Glauben der Menschen an ihr Geld und dessen Wert. Erst wenn seine Kaufkraft merklich nachlässt, kommt es zum Abschied von dieser Illusion. Das war in Europa zuletzt während der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts der Fall. Damals wurde aus der Geld- die Goldillusion, das heißt, der Glaube an das Geld, das seit Jahrtausenden auf allen fünf Kontinenten eine hohe Wertschätzung erfährt, eben Gold. Der Silberpreis stieg seinerzeit prozentual sogar noch stärker als der Goldpreis, fiel danach aber auch tiefer. Achten Sie in nächster Zeit auf die Reizschwelle, von der an die Geld- zur Goldillusion mutiert, und investieren Sie dann den Großteil Ihres Geldes, außer in haltbare Güter des täglichen Bedarfs, auch in die beiden Edelmetalle Gold und Silber.
Inflation bedeutet im engeren Sinn Aufblähung der Geldmenge, im weiteren Sinn, vor allem auch im Volksmund: Preisanstieg von Konsumgütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs, zum Beispiel von Lebensmitteln, Strom, Benzin und Mieten. Umgekehrt betrachtet: Inflation bedeutet Geldentwertung, sodass 100 Euro bei 2 Prozent Inflation nach einem Jahr 98 Euro wert sind, bei 5 Prozent Inflation 95,2 Euro und bei 10 Prozent Inflation nur noch 90,9 Euro.
Geldmenge, das ist nach der Definition der Deutschen Bundesbank der Geldbestand bei inländischen Nichtbanken, etwa bei Unternehmen und Privatpersonen. Jetzt wird es etwas kniffliger: Im Eurosystem unterscheidet man zwischen M1, M2 und M3. Hinter M1 verbirgt sich der Bargeldumlauf ohne Kassenbestände der monetären Finanzierungsinstitute, zum Beispiel Banken und Sparkassen, zuzüglich der täglich fälligen Einlagen der im Währungsgebiet ansässigen nicht monetären Finanzierungsinstitute. M2 bedeutet: M1 zuzüglich Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist bis zu drei Monaten. M3 schließlich umfasst zusätzlich zu M2 auch Geldmarktfonds, Repoverbindlichkeiten – das sind Geldmarktpapiere über zwei Jahre – und Bankschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert sich an M3.
Inflation wird in Deutschland üblicherweise am Verbraucherpreisindex (VPI) gemessen, im Euroraum am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Die Ergebnisse beider Indizes unterscheiden sich etwas. Das liegt unter anderem am Konjunkturverlauf, der in einem Euroland positiv, in einem anderen neutral oder sogar negativ sein kann. Da Lebensmittel- und Energiepreise stark schwanken, rechnet man sie aus der Inflationsrate heraus, wenn es darum geht, den Inflationstrend zu ermitteln. Das Ergebnis ist dann die Kerninflation.
Inflation tritt in vielen Varianten auf: schleichend, trabend, galoppierend, selten – dann allerdings gewaltig – als Hyperinflation (wie während der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Deutschland und jahrzehntelang in verschiedenen Ländern Südamerikas). Es gibt die zurückgestaute Inflation (wie während des Dritten Reichs), die importierte und sogar die gefühlte Inflation, die nach der Euro-Einführung die deutschen Gemüter erhitzte. Nicht zu vergessen die sogenannte Asset Inflation, die 2009 global einsetzte. Darunter versteht man im engeren Sinn den kräftigen Anstieg der Aktien- und Anleihenkurse sowie der Immobilienpreise.
Die EZB peilt für den Euroraum ein Inflationsziel von unter, aber nahe 2 Prozent an. Aus welchem Grund? Weil einerseits genug Abstand zur totalen Geldwertstabilität bei 0 Prozent gewahrt bleiben soll, andererseits keine allgemeine Inflationsmentalität aufkommen darf. 0 Prozent würde nämlich die EZB-Geldpolitik durchkreuzen und das Gespenst der Deflation – der Geldwert steigt, staatliche und private Schuldner drohen pleite zu gehen – auf den Plan rufen. Das brächte im Extremfall sogar das auf hohen Schulden aufgebaute Wirtschafts- und Währungssystem zum Einsturz. Demgegenüber würden mehr als 2 Prozent Inflation bei anhaltender Teuerung die Inflationserwartungen schüren und hier oder da sogar zu Hamsterkäufen führen: Aus Inflation entstünde dann noch mehr Inflation.
Das Inflationsziel anzupeilen, ist eine Sache, es zu erreichen und dann festzuhalten, eine andere. Der EZB-Rat unter Präsident Mario Draghi gibt sich da offenbar der Illusion hin, dieses Kunststück fertigbringen zu können – ohne zu berücksichtigen, dass Inflation keine starre Zahl, sondern ein dynamischer Prozess ist. Werfen Sie ein Auge darauf, denn die Geldpolitik bestimmt, wie es an den Börsen weiter geht.
Deflation bedeutet: Die Preise sinken, Sachwerte wie Immobilien und ganze Unternehmen einschließlich deren Aktien verlieren an Wert, während Geldwerte (zum Beispiel Geld auf dem Konto, Anleihen und Rentenfonds) an Wert gewinnen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischen Inflation und Deflation Asymmetrie herrscht. Das bedeutet: Steigen die Preise, sind Schuldner die Gewinner und Gläubiger die Verlierer. Sinken die Preise dagegen, gewinnen die Gläubiger nur dann, wenn die Schuldner zahlungsfähig bleiben – was während einer Deflation eher selten vorkommt. Von daher gesehen wird auch klar, warum alle Notenbanken der Welt in den vergangenen Jahren die Bekämpfung der Deflation auf ihre Fahnen geschrieben haben: Weil sie sich damit die Legitimation für ihre ungehemmte Inflationspolitik, also für das Schuldenmachen, verschafft haben.
Nicht nur Bares ist Wahres
In der Finanzsprache gibt es einen Begriff, der so unterschiedlich verwendet wird, dass er hier der Klärung bedarf: Liquidität. Darunter versteht man zum Ersten Geld, sei es auf einem Konto oder anderswo deponiert, etwa als Bargeld im Portmonee, im heimischen Safe oder unter der Matratze. Zum Zweiten umfasst der Liquiditätsbegriff die Zahlungsfähigkeit, also jederzeit in der Lage zu sein, Rechnungen zu begleichen oder sonstige Schulden abzutragen. Und zum Dritten bezeichnet man als Liquidität die Liquidierbarkeit, das heißt, die Möglichkeit, etwas zu Geld machen zu können (zu liquidieren). Vor allem bezüglich der an zweiter Stelle genannten Liquidität handelt es sich um eine absolut notwendige Bedingung.
Über die hier genannten klassischen Liquiditätsbegriffe hinaus spricht man auch bei der Geldpolitik der Zentralbanken von Liquidität, und zwar im Sinn von Geldmenge. Aktien, Anleihen und sonstige Wertpapiere werden als liquide bezeichnet, wenn genug von ihnen ausgegeben sind und entsprechend viel an Börsen gehandelt werden. Schließlich beschäftigen sich auch Finanzvorstände und Aktienanalysten auf ihre Weise mit der Liquidität: Indem sie ihr eine je nach Liquiditätsgrad hohe oder niedrige Kennzahl zuordnen. Bei der privaten Finanzplanung sollte die Liquidität im eingangs genannten dreifachen Sinn eine zentrale Rolle spielen, und zwar dauerhaft.
Читать дальше